Ängste: vernichtender als offene Gewalt
 An seinem ersten Arbeitstag an der Universität von Bath springt der Psychologe Joe O’Loughlin für einen Kollegen ein: Auf Bitten der Polizei versucht er, eine Selbstmörderin davon abzuhalten, in den Tod zu springen. Die Frau steht auf der Brüstung einer viel befahrenen Brücke, nur bekleidet mit roten Pumps, auf ihrem Bauch steht mit Lippenstift das Wort »Hure« geschrieben. Fortwährend telefoniert sie mit ihrem Handy. Als O’Loughlin sich ihr nähert, wendet sie sich ihm kurz zu, sagt: »Sie verstehen nicht« und springt. Ganz offenkundig Selbstmord. Doch als kurze Zeit später die Geschäftspartnerin und Freundin der Toten im Wald gefunden wird – erfroren, an einen Baum gekettet, zu ihren Füßen wiederum ein Handy -, zeichnet sich ab, dass mehr hinter diesen Todesfällen steckt.
An seinem ersten Arbeitstag an der Universität von Bath springt der Psychologe Joe O’Loughlin für einen Kollegen ein: Auf Bitten der Polizei versucht er, eine Selbstmörderin davon abzuhalten, in den Tod zu springen. Die Frau steht auf der Brüstung einer viel befahrenen Brücke, nur bekleidet mit roten Pumps, auf ihrem Bauch steht mit Lippenstift das Wort »Hure« geschrieben. Fortwährend telefoniert sie mit ihrem Handy. Als O’Loughlin sich ihr nähert, wendet sie sich ihm kurz zu, sagt: »Sie verstehen nicht« und springt. Ganz offenkundig Selbstmord. Doch als kurze Zeit später die Geschäftspartnerin und Freundin der Toten im Wald gefunden wird – erfroren, an einen Baum gekettet, zu ihren Füßen wiederum ein Handy -, zeichnet sich ab, dass mehr hinter diesen Todesfällen steckt.
Gewagt und gelungen
Michael Robotham kommt ohne viel Blutvergießen oder Gemetzel aus. Sein Täter berührt die Opfer nicht, allein durch Worte vernichtet er sie, nimmt ihnen alle Würde und treibt sie in den Tod.
Es gibt einen Moment, in dem alle Hoffnung vergeht, aller Stolz schwindet, alle Erwartungen, aller Glaube, alles Sehnen. Dieser Moment gehört mir. Dann höre ich den Klang einer zerbrechenden Seele.
Es ist kein lautes Knacken wie von splitternde Knochen, wenn ein Rückgrat bricht oder ein Schädel birst. Auch nicht weich und feucht wie ein gebrochenes Herz. Es ist der Klang, bei dem man sich fragt, wie viel Schmerz ein Mensch ertragen kann; ein Laut der das Gedächtnis zerschmettert und die Vergangenheit in die Gegenwart sickern lässt; ein Ton, so hoch, dass nur die Hunde der Hölle ihn hören können.
Von mehreren Passagen aus Sicht des Täters abgesehen, wird das Geschehen vom klinischen Psychologen Joe O’Loughlin in der ersten Person singular und im Präsenz geschildert. So gewagt dies ist, so gelungen ist es auch. Denn Michael Robotham stimmt Sprache, Stil und Tempo des Romans perfekt auf seine Hauptfigur ab. Obwohl viel passiert, bleibt der Duktus vorsichtig, zurückhaltend, misstrauisch und sehr reflektiert. Oft durchsetzt mit einem feinen, tiefschwarzen, bitteren Humor. Und obwohl man als Leser O’Loughlin so nah kommt, entsteht doch nie das Gefühl von Nähe. Bei aller Offenheit bleibt die Hauptfigur distanziert und eigenständig.
Tiefenspannung
»Dein Wille geschehe« ist bereits der vierte Thriller Robothams um die Figur des Joe O’Loughlin. Anders als verschiedene Profiler, die heute die Krimiwelt bevölkern, muss der klinische Psychologe seine Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen, weder glorifizieren noch mystisch überhöhen. Er ist kompetent und erfahren, bleibt insgesamt aber eher unauffällig, und das mit Absicht: Denn O’Loughlin leidet an Parkinson. Seine linke Hand, sein linker Arm beginnen mitunter unkontrolliert zu zittern, die Mimik wird starr. Hält er eine Vorlesung, hofft er, dass sein linkes Bein nicht plötzlich blockiert und er vom Podium stürzt. Aufmerksamkeit möchte er vermeiden. Kein Held, sondern ein Mensch mit sehr nachvollziehbaren Ängsten, Unsicherheiten und Problemen.
Robothams Thriller lebt von der Glaubwürdigkeit seiner Figuren. Mit viel Gespür für innere Zusammenhänge und Widersprüche sind sie facettenreich und lebendig gezeichnet. Darum kann der Australier auf plumpe Spannungsmache verzichten. Er packt den Leser auf den ersten Seiten sehr perfide an tiefen Ängsten und lässt ihn bis zum Ende nicht wieder los.
 Michael Robotham: Dein Wille geschehe
Michael Robotham: Dein Wille geschehe
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Goldmann Verlag 2009
geb., 576 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-442-31178-1
auch erhältlich als eBook (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch-Download (hier klicken)
Diese Rezension ist auch erschienen auf satt.org
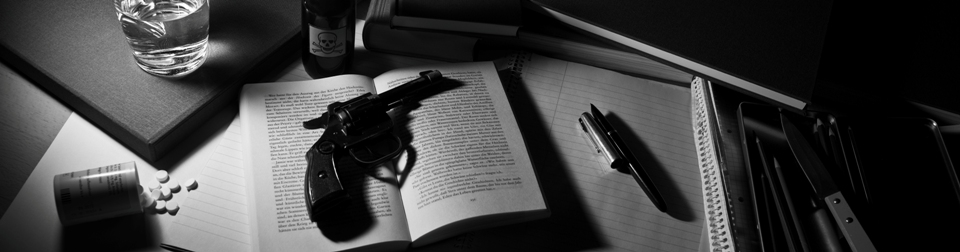
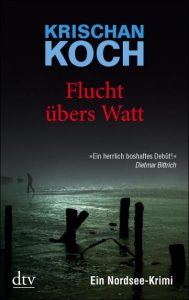

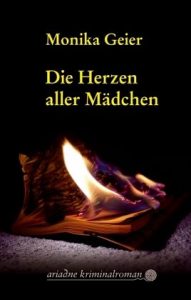
 beschuldigt, einen andern Unfall mit tödlichem Folgen verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben. Das Unfallauto ist auf seinen Namen zugelassen. Nicht einmal seine Pflichtverteidigerin scheint Bellicher zu glauben, der beteuert, nichts davon zu wissen.
beschuldigt, einen andern Unfall mit tödlichem Folgen verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben. Das Unfallauto ist auf seinen Namen zugelassen. Nicht einmal seine Pflichtverteidigerin scheint Bellicher zu glauben, der beteuert, nichts davon zu wissen.