Im Garten ihres neuen Hauses entdeckt Julia Hamill menschliche Knochen. Offensichtlich handelt es sich um eine Frau, und die Kopfverletzungen, die sie erlitten hat, deuten darauf hin, dass sie erschlagen wurde. Allerdings liegt die Tat in weiter Vergangenheit: Vermutlich wurde die  Leiche um 1830 hier verscharrt. Gemeinsam mit einem Verwandten der Vorbesitzerin des Hauses macht sich Julia auf die Suche nach Erklärungen. Wer war die Frau? Und warum wurde sie getötet? Die Spuren führen geradewegs ins Boston des 19. Jahrhunderts, zu einem unheimlichen Serienmörder und in die Geschichte der Medizin.
Leiche um 1830 hier verscharrt. Gemeinsam mit einem Verwandten der Vorbesitzerin des Hauses macht sich Julia auf die Suche nach Erklärungen. Wer war die Frau? Und warum wurde sie getötet? Die Spuren führen geradewegs ins Boston des 19. Jahrhunderts, zu einem unheimlichen Serienmörder und in die Geschichte der Medizin.
Die Spurensuche in der Gegenwart bildet die Rahmengeschichte, das eigentliche Geschehen spielt im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Routiniert verknüpft Tess Gerritsen ihre Handlungsstränge, mischt Elemente des Schauerromans, der Romantic Novel und des Serienmörderthrillers, im Mittelpunkt ein Fräulein in Nöten. Das Buch stieg kurz nach Erscheinen ziemlich hoch in die Spiegel-Bestsellerliste ein und blieb dort für mehrere Wochen. Und dafür ist es auch geschrieben: Teeplätzchen-Literatur mit Gänsehautgarantie.
Aber bei aller Routine und Bestsellerabsicht, die dahinter stehen mag: Tess Gerritsen versteht ihr Handwerk, „Leichenraub“ ist nun auch schon der zwölfte Titel, der von ihr auf Deutsch erschienen ist. Das Buch ist gut geschrieben, die Figuren lebendig motiviert, der Plot sauber und spannend gearbeitet. Und es ist reichlich blutig. Gerritsen hat Medizin studiert und als Ärztin gearbeitet, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Das merkt man ihren Büchern deutlich an. Fachkundig wird geschildert, wie Operationen vorgenommen und Leichen seziert werden. In „Leichenraub“ ist es eine Amputation, die en detail beschrieben wird. Das ist nicht immer leicht zu lesen.
Auch die Opfer kommen mit viel Blut und offenem Gedärm ums Leben – doch diese Taten werden nie so ausführlich geschildert wie zum Beispiel die Obduktion, in der es darum geht, der Tat und dem Täter auf die Spur zu kommen. Das wirkt gegenüber dem Opfer durchaus respektvoll. Nicht sein Tod und seine Schändung wird ausgeschlachtet, sondern das Gewicht wird auf die Aufklärung des Mordes gelegt. Dafür darf dann in der sauberen Atmosphäre des Obduktionssaales das letzte verbliebene Blut fließen und der Darm entrollt werden. Das wirkt nicht ganz so sensationslüstern, da der Blick in die Bauchhöhle einem höheren Zweck dient.
Das meine ich nun nicht nur ironisch. Ich mag die Bücher von Tess Gerritsen – solange ich nicht zu viele davon hintereinander lese und solange ich nicht zu sehr darüber nachdenke. Es wird Gewalt und Gedärm benutzt, um Leser anzulocken, der medizinische Anstrich macht das alles moralisch etwas vertretbarer – okay. Das ist Popcorn-Serienmörder-Thrillerei, Teeplätzchen-Belletristik. Aber es ist gutes Handwerk. Es ist verständlich motiviert, spannungsreich aufgebaut, es ist in sich logisch und geschlossen. Die Doppelmoral ist in einem vertretbaren Maß gehalten – nicht viel anders als in jedermanns Leben. Ich kann mich beim Lesen entspannt zurücklehnen, in Leben und Tode versinken, die nichts mit mir zu tun haben, und mich von fremden Gefühlen unterhalten lassen. Ich ärgere mich nur selten während des Lesens (nur wenn der Schmonzes um die Seelenverwandtschaft der Liebenden dann doch zu arg wird).
Die Bücher von Tess Gerritsen bringen weder das Genre noch die Welt voran. Aber das wollen sie auch nicht. Sie wollen unterhalten. Und das machen sie gut. Das ist doch auch mal in Ordnung – so für zwischendurch.
Ach so: Es taucht in „Leichenraub“ zwar kurz eine von Gerritsens Serienheldinnen auf, doch ansonsten gehört das Buch nicht zur Serie um die Pathologin Maura Isles und Detective Jane Rizzoli.
 Tess Gerritsen: Leichenraub
Tess Gerritsen: Leichenraub
Deutsch von Andreas Jäger
Limes Verlag 2008, 447 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-8090-2539-9
auch lieferbar als eBook (hier klicken)
auch lieferbar als Hörbuch-Download (hier klicken)
Diese Besprechung ist auch erschienen auf satt.org
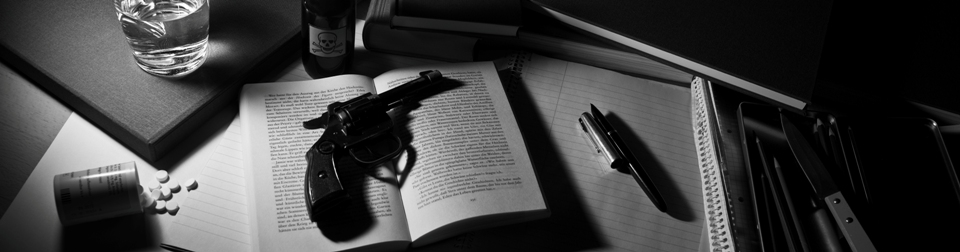


 Erniedrigung. Ob man ihn erwischt, ist ihm egal, es sind ja nur noch sieben Tage, dann ist er tot.
Erniedrigung. Ob man ihn erwischt, ist ihm egal, es sind ja nur noch sieben Tage, dann ist er tot. hilflos trinkend vor dem Fernseher. Die beiden Zwillingsschwestern, wenig älter als Anita, stürzen sich leicht bekleidet ins Londoner Nachtleben. Der große Bruder verfügt plötzlich über Dinge, für die er eigentlich gar kein Geld hat. Und dazwischen, nein, eher daneben: Anita, isoliert, zurückgezogen, schweigsam, nach dem Tod der Mutter desorientiert und verwirrt. Und sie ist schreckliche dreizehn Jahre alt – das Alter, das wirklich das entsetzlichste, das aufwühlendste und verstörendste ist. Anita gehört zu den Kindern, die stets außerhalb stehen, in der Familie wie in der Schule. Ihre pakistanisch-britische Abstammung macht es ihr dabei nicht einfacher.
hilflos trinkend vor dem Fernseher. Die beiden Zwillingsschwestern, wenig älter als Anita, stürzen sich leicht bekleidet ins Londoner Nachtleben. Der große Bruder verfügt plötzlich über Dinge, für die er eigentlich gar kein Geld hat. Und dazwischen, nein, eher daneben: Anita, isoliert, zurückgezogen, schweigsam, nach dem Tod der Mutter desorientiert und verwirrt. Und sie ist schreckliche dreizehn Jahre alt – das Alter, das wirklich das entsetzlichste, das aufwühlendste und verstörendste ist. Anita gehört zu den Kindern, die stets außerhalb stehen, in der Familie wie in der Schule. Ihre pakistanisch-britische Abstammung macht es ihr dabei nicht einfacher.