Der Realität eine Chance – auch in Kriminalromanen
Aus vielerlei Gründen ist es gar nicht so einfach, einen Menschen umzubringen. In Krimis ist dies zwar das tägliche Geschäft. Aber Krimis sind ja auch Fiktion, ihre Figuren und deren Motivationen weitgehend frei erfunden. Doch auch in den Punkten, in denen Krimis versuchen, sich der Wirklichkeit anzunähern, herrscht oft große Fabulierlust: Menschen werden in Sekunden- schnelle erwürgt, Staats- anwälte oder gar Polizeichefs stellen Haft- befehle aus, Gerichts- mediziner können allein durch Handauflegen den Zeitpunkt des Todes auf zwei Stunden eingrenzen.
Das Handbuch von Krimiautorin Christine Lehmann und Fahnder Manfred Büttner räumt auf mit diesen und vielen weiteren Schnitzern und groben Verfälschungen. Ebenso kompetent und fundiert wie witzig und frech klären die beiden auf: Welche Wunden schlagen welche Mordwerkzeuge, wie wird tatsächlich ermittelt, was passiert bei der Obduktion. Diese und viele weitere Fragen beantwortet das künftige Kompendium von Krimiautorinnen und -autoren. Ein besonderes Bonbon – wenn man so will – ist die Übersicht über tödliche Gifte und ihre Wirkungen. (Wenn Sie hier klicken, kommen Sie zur Besprechung des Buches.)
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Sachbuch zu schreiben?
Lehmann: Wir beide gucken gerne Krimis im Fernsehen, lesen gerne Krimis, und vor allem bei Fernsehkrimis fallen Fehler auf – also, wenn man zum Beispiel eine schöne Leiche sieht und dann erfährt, dass die drei Wochen im Wasser gelegen haben soll. Das kann einfach nicht sein. Die sieht dann nicht gut aus. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten in Krimis, die nicht so laufen, wie sie eigentlich in der Wirklichkeit laufen würden. Irgendwann war mir das zu viel. Da habe ich gedacht, wir müssen da mal was schreiben. Deshalb hab ich Manfred Büttner gefragt, der mich seit Jahren berät. Und der war sofort Feuer und Flamme.
Büttner: Auch aus Ermittlersicht läuft da einiges schief. Obwohl – logisch, das wissen wir auch und das kommt im Buch hoffentlich hinreichend rüber: dass es ist nicht darum geht, dass die Wirklichkeit eins zu eins abgebildet wird. Aber wenn dann Sachen da sind, die so überhaupt gar nicht passen, dann stört’s einen gelegentlich doch. Deswegen bin ich auch gern mit eingestiegen.
Können Sie heute noch Krimis lesen oder sehen, ohne dabei nervös und kribbelig zu werden, weil Sie denken, das geht doch so nicht?
Lehmann: Ja, mir geht das so. Wenn zum Beispiel zum hundertsten Mal der Chef der Polizei einen Durchsuchungsbeschluss ausstellt. Wobei es nicht nur so ist, dass das in Krimis verkehrt läuft, das läuft oft auch in Nachrichtensendungen verkehrt. Also, wenn der Staatsanwalt einen Haftbefehl ausstellt, das geht halt einfach nicht. Uns lag am Herzen zu sagen, dass unser Rechtsstaat immer noch ein Rechtsstaat ist und nach bestimmten Regeln funktioniert. Das ist auch wichtig.
Büttner: Manche Sachen sind einfach von der Begrifflichkeit her falsch. Im Moment hat sich in der Nachrichtensprache zum Beispiel das Wort »Razzia« statt »Durchsuchung« durchgesetzt. Aber unter einer Razzia versteht man was Besonderes nach dem Polizeirecht. Razzien in dieser Form gibt es in Deutschland einfach nicht. Und das aus gutem Grund. Wenn solche Begriffe unterschiedlich oder einfach auch falsch verwendet werden, stolpert man halt drüber. Aber es ist auch so, dass mich in Krimis manches nicht stört, weil die halt weit ab von der Realität sind, da gehört das dann einfach dazu.
Lehmann: Was mir wahnsinnig gegen den Strich geht, ist die Art und Weise, wie die Polizei in Krimis mit Zeugen und Tatverdächtigen umgeht. Viele Krimis funktionieren ja so, dass die Ermittler irgendwann anfangen, einen, der eigentlich als Zeuge geladen ist und ganz harmlos dasitzt, ohne Vorwarnung zu überführen. Sie schreien ihn an, sie setzen ihn unter Druck, sie bedrohen ihn, sie tricksen ihn sogar aus. Und er hat keine Chance, und denkt auch gar nicht daran, dass er einen Anwalt dazu holen kann. Das stört mich sehr, denn so entsteht der Eindruck bei einem Normalbürger wie mir, dass, wenn ich als Zeugin womöglich mal in Verdacht gerate, mir so etwas auch passieren kann. Dass ich kaum Rechte habe. Ich bin mal an der DDR-Grenze sechs Stunden lang verhört worden. Ich weiß, wie das ist und wie sich das anfühlt. Ich möchte nicht glauben, dass so etwas bei unserer Polizei auch möglich ist und dass ich wirklich Angst haben muss.
Es fragt sich ja auch, wie weit Fiktion nicht wieder auf die Realität abfärbt.
Büttner: Das ist gar nicht so weit hergeholt. Es gibt den Erfahrungswert, dass man in Situationen, die man nicht oft erlebt, auf Vorbilder zurückgreift. Da muss man sich halt irgendwie verhalten. Ich erinnere mich an eine Schutzpolizistin, die im Streifendienst tätig war und dann mal jemanden festnehmen musste. Etwas, das aus dem normalen Streifenalltag herausgefallen ist. Der Festgenommene hat beharrt: »Ich habe doch das Recht auf einen Anruf.« Und die Polizistin – vielleicht hat sie da bei der Ausbildung auch nicht richtig aufgepasst -, die hat auch gedacht, na, so müsste es wohl sein. Es ist völlig klar, woher sie das hat: aus den typischen amerikanischen oder angelsächsischen Krimis. Krimis können durchaus eine Lehrfunktion Richtung Polizei haben.
Lehmann: Auch Polizisten lesen Krimis.
Büttner: Aber es ist schon so, dass, wenn es sich um entsprechend dramatische Sachen handelt – Kapitaldelikte in irgendeiner Form -, dann sind überwiegend erfahrene Fachleute dabei, weil das sehr, sehr institutionalisiert abläuft. Da kommt es nicht vor, dass jemand vernommen wird und der Anwalt sitzt nicht dabei. Das gibt es einfach nicht. Das ist nur im Fernsehkrimi so, dass einer alleine einen Zeugen befragt.
Lehmann: Was mich sehr beschäftigt, ist der Profiler, weil der heute in unsere Krimis Einzug hält. Deswegen ist mein Kapitel über den Profiler, der eigentlich ein Fallanalytiker ist, relativ lang geraten, weil mir klar geworden ist, dass alle Profiler, die in deutschen Krimis vorkommen, vollkommen falsch dargestellt sind. In zwei, drei Jahren mag das gar keine Rolle mehr spielen, aber jetzt ist das völlig daneben. Die werden als Psychologen mit genialer Intuition dargestellt, aber es sind in Wirklichkeit Polizisten, die mit Statistiken arbeiten. Und auch das wiederum in einer sehr streng formalisierten Art und Weise. Das ist meines Erachtens in Krimis bisher noch gar nicht dargestellt worden. Wird auch in amerikanischen Krimis nicht dargestellt. Der Profiler ist derzeit diese neu aufkommende Figur, die wieder den genialen Detektiv zurückbringt, einer, der sich auf seine Spürnase verlässt, der sich in den Täter hineinversetzt, dessen Gefühle nachvollzieht und dann praktisch dessen Verbrechen begeht. Also der alte Father Brown. Das ist in der Realität überhaupt nicht so. Und trotzdem ist die Arbeit der Fallanalytiker sehr, sehr spannend.
Solche Dinge richtig zu stellen, ist auch ein Anliegen Ihres Handbuches. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Lehmann: Nun, ich hatte Zeit – Zeit ist auch immer eine wichtige Voraussetzung – und dachte, jetzt ist der Punkt gekommen, um das in Angriff zu nehmen. Darum habe ich mich mit Manfred Büttner beraten, wie wir das machen könnten. Man recherchiert ja immer, wenn man einen Krimi schreibt, und ich hab mich schon in so viele Gebiete eingelesen und mir selbst Wissen angeeignet, dass ich das nun anderen leichter machen wollte. Damit Autorinnen nicht bei null anfangen, sondern die Basics schon zusammengetragen sind. Wenn sie dann etwas Besonderes suchen, sollen sie selbst recherchieren. Die Recherche an sich wollen wir ja niemandem abnehmen. Es fehlt auch bestimmt einiges. Aber es ist schon eine Menge zusammengekommen.
Büttner: Wir haben uns thematisch einfach aufgeteilt. Ich habe eher die polizeiinternen Geschichten gemacht, also das, was man unter Fachleuten das Strafprozessuale nennt: die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit, die gerichtliche Tätigkeit, was machen Ermittler, wie sieht es dann vor Ort aus, wie geht man miteinander um und so. Wenn so etwas zumindest ansatzweise im Krimi auftaucht, dann ist das schon näher an der Realität.
Lehmann: Abgesehen davon macht es die Krimis auch schöner. Denn manchmal steckt in der Polizeiarbeit selbst oder in einem Ermittlungsansatz schon eine Geschichte. Wenn man das weglässt, hat man die Geschichte gar nicht. Oder man hat in den Hierarchien der Polizei bereits ein Drama, das man für einen Krimi verwenden kann. Also ich finde, dass in der Realität oft Geschichten stecken, die wir nicht entdecken, wenn wir nur phantasieren.
Herr Büttner, Sie kommen eher von der Wirtschaftsseite, oder? Was machen Sie genau?
Büttner: Ich bin von Haus aus Steuerfahnder und habe seit einigen Jahren sowohl an der Hochschule für Finanzen als auch an der Hochschule der Polizei Lehraufträge, sodass ich auch im Fortbildungsbereich tätig bin. Auf diese Weise habe ich recht vielfältige Berührung mit der Polizeiausbildung. Aber mein eigentlicher Schwerpunkt sind Wirtschaftsstrafsachen.
Sie beide kennen sich schon lange …
Lehmann: Wir kennen uns seit zwanzig Jahren, ja.
Aber das Handbuch ist Ihre erste Zusammenarbeit – also zumindest in dieser Form.
Lehmann: Wie schon gesagt: Manfred berät mich seit Jahren, seine Informationen sind immer wieder in meine Krimis eingeflossen, nur dass ich sie halt sonst selbst in die Maschine getippt habe. Aber das Handbuch ist tatsächlich das erste Buch, das wir gemeinsam geschrieben haben
Frau Lehmann, Sie schreiben nicht nur Krimis, sondern sind auch journalistisch tätig.
Lehmann: Ja, ich bin beim SWR Nachrichtenredakteurin und Politikredakteurin.
Hat das Einfluss auf Ihre Krimis?
Lehmann: Gar nicht! Natürlich gibt es da die spektakulären Fälle, dass ein totes Kind in einem Blumentopf gefunden wird oder dass ein Mann seine Frau und seine Kinder erschießt, oder eine Mutter bringt ihre Kinder um. Diese Sachen kommen mir natürlich auf den Schreibtisch, und man meldet das dann als Nachricht. Aber ich habe noch keinen Krimi geschrieben, in dem so etwas eine Rolle gespielt hätte, und zwar deswegen, weil der Krimi etwas anderes ist. Normalerweise ist ein Verbrechen relativ schnell aufgeklärt mit den Mitteln, die man heute hat. Die echte Kriminalität ist ja meist rechtbanal. Der Krimi aber erzählt ein menschliches Drama. Und er macht es kompliziert, auch die Aufklärung. Da weiß man halt nicht sofort, wer’s war – zumindest in meinen Krimis, aber es gibt natürlich auch andere Formen. Aber deswegen spielen die realen Fälle in meinen Krimis kaum eine Rolle.
Gut, die realen Fälle nicht, aber doch der soziale Hintergrund von Fällen oder Themen, oder?
Lehmann: Ja, aber das wüsste ich auch, wenn ich ganz normal fernsehen würde. Dazu muss man nicht Nachrichtenredakteurin sein, denke ich. Vielleicht muss man Journalistin sein, um zu recherchieren. Da spielt es sicherlich eine Rolle, aber die Nachrichten selbst haben keine große Bedeutung für meine Krimis.
Herr Büttner, Sie haben ein Fachbuch geschrieben über – äh, Vermögensabschöpfung, nicht wahr? Aber bislang nichts Belletristisches?
Büttner: Nein, nein. In der Belletristik habe ich bisher nichts veröffentlicht. Aber halt das Fachbuch zum Thema Vermögensabschöpfungen von illegal erworbenen Vermögenswerten. Da geht es letztlich darum, dass man Straftätern das, was sie aus einer strafbaren Handlung bezogen haben, wieder wegnimmt. In den Vorlesungsmanuskripten bemühe ich mich vielleicht, der Belletristik etwas näher zu kommen, suche nach anschaulichen Beispielen, um mich verständlicher auszudrücken. Als wir das Handbuch geschrieben haben, da war es aber schon so, dass ich mich immer am Riemen reißen musste, um nicht zu fachbuchig zu werden. Christine Lehmann hat mich dann immer wieder auf den Weg gebracht, hat gemahnt, das muss verständlicher werden oder darf nicht so juristisch klingen.
Lehmann: Es kam uns in diesem Buch auch darauf an, dass wir niemandem nahelegen, wie man Verbrechen begeht. Das geht mir übrigens bei jedem Krimi so, in dem ich eine Mordmethode schildere, die für jeden nachvollziehbar ist. Ich mach das dann immer so, dass irgendein Element nicht stimmt, sodass man es nicht so leicht imitieren kann. Das ist natürlich ebenfalls in diesem Handbuch so. Wir stellen ja auch verschiedene Gifte vor. Aber es ist schon so, dass man mit Gift nicht so leicht morden kann, und auf die Mengenangaben, die wir gemacht haben, würde ich mich nicht verlassen. Da habe ich eher zu tief gegriffen.
Werden Sie nicht schief angeguckt, wenn Sie zum Beispiel einen Arzt fragen, ob ein Medikament in größerer Dosis tödlich wirken kann?
Lehmann: Ich hab mehrere Ärzte gefragt und festgestellt, dass die sich nicht mit dem Morden beschäftigen möchten. Wenn die einen nicht kennen, werden sie schon mal misstrauisch, was man denn vorhat. Das lasse ich jetzt auch. Es gibt ja genügend andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich habe auch mal einen ADAC-Menschen gefragt, wie man denn Bremsen beschädigt. Das war dem ganz unangenehm. Der war kurz davor, die Polizei zu rufen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Zum Bestellen bei eBook.de einfach auf den Titel klicken:
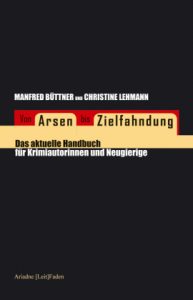 Christine Lehmann & Manfred Büttner: Von Arsen bis Zielfahndung
Christine Lehmann & Manfred Büttner: Von Arsen bis Zielfahndung
Das aktuelle Handbuch für Krimiautorinnen und Neugierige
Ariadne im Argument Verlag 2009
kart., 250 Seiten, 16,90 Euro
ISBN 978-3-88619-720-0
Eine leicht gekürzte Fassung dieses Interviews ist bereits im Titel-Magazin erschienen.
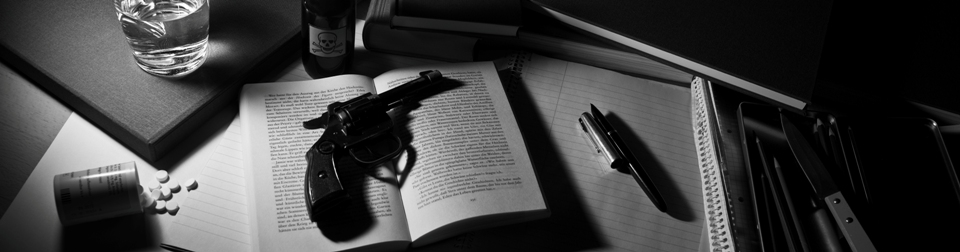
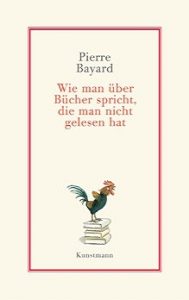 lähmenden Respekt vor Literatur, gerade vor der sogenannten Hochliteratur abzustreifen, um einen persönlichen Zugang zu Büchern zu finden und über sie zu sprechen.
lähmenden Respekt vor Literatur, gerade vor der sogenannten Hochliteratur abzustreifen, um einen persönlichen Zugang zu Büchern zu finden und über sie zu sprechen. Mindestens 24 Mal wurde »Der Hund der Baskervilles« verfilmt, unvergessen die musikalische Interpretation von Cindy und Bert 1970 unter Verwendung von »Paranoid« von Black Sabbath (das »Video« mit Großaufnahmen eines Mopses, wahrhaft spooky). Anhand dieser Geschichte demonstriert Bayard das, was er »Kriminalkritik« nennt:
Mindestens 24 Mal wurde »Der Hund der Baskervilles« verfilmt, unvergessen die musikalische Interpretation von Cindy und Bert 1970 unter Verwendung von »Paranoid« von Black Sabbath (das »Video« mit Großaufnahmen eines Mopses, wahrhaft spooky). Anhand dieser Geschichte demonstriert Bayard das, was er »Kriminalkritik« nennt: fünfzehnjährige John vermutet dahinter einen Serienmörder. Und John muss es wissen: Er ist geradezu besessen von diesem Thema, hält er sich doch selbst für einen angehenden Serienkiller. Als Beleg dient ihm unter anderem Macdonalds Triade, die vollständig auf ihn zutrifft: Bettnässen, Pyromanie und Tierquälerei. Sein Psychotherapeut versucht vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
fünfzehnjährige John vermutet dahinter einen Serienmörder. Und John muss es wissen: Er ist geradezu besessen von diesem Thema, hält er sich doch selbst für einen angehenden Serienkiller. Als Beleg dient ihm unter anderem Macdonalds Triade, die vollständig auf ihn zutrifft: Bettnässen, Pyromanie und Tierquälerei. Sein Psychotherapeut versucht vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.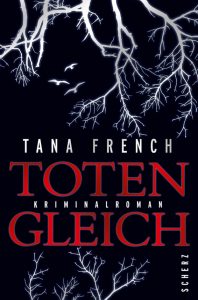 In einem heruntergekommenen Cottage wird eine junge Frau erstochen aufgefunden. Sie scheint Detective Cassie Maddox wie aus dem Gesicht geschnitten. Und damit nicht genug, sie trägt einen Namen, den Maddox vor Jahren als Undercoveragentin benutzt hatte, um sich in einen Drogendealerring einzuschleusen. Eine fiktive Identität, die sich offenbar jene Tote zunutze gemacht hat.
In einem heruntergekommenen Cottage wird eine junge Frau erstochen aufgefunden. Sie scheint Detective Cassie Maddox wie aus dem Gesicht geschnitten. Und damit nicht genug, sie trägt einen Namen, den Maddox vor Jahren als Undercoveragentin benutzt hatte, um sich in einen Drogendealerring einzuschleusen. Eine fiktive Identität, die sich offenbar jene Tote zunutze gemacht hat.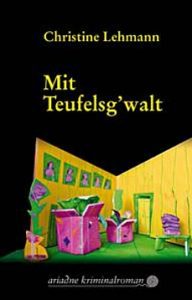 Christine Lehmann: Mit Teufelsg’walt
Christine Lehmann: Mit Teufelsg’walt