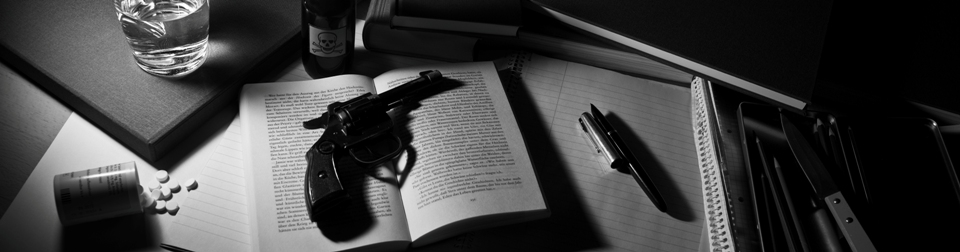Für einen entsakralisierten Umgang mit Literatur
Shakespeare, Balzac, Musil: Weltliteratur, hohes Bildungsgut: geschätzt, verehrt – und nicht gelesen. Die meisten Menschen machen einen Bogen um die Bücher, die zum Bildungskanon zählen, zentnerschwer scheint die Last, die auf einen niederzugehen droht, sobald man sie aufschlägt. Von Langeweile ganz zu schweigen.
Umso notwendiger und erfrischender die Herangehensweise des französischen Literaturprofessors und Psychoanalytikers Pierre Bayard, der für einen lebendigen und kreativen Umgang mit Literatur plädiert. Zwei Bücher von ihm sind bislang auf Deutsch erschienen: »Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat« (im Original: »Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?«) und »Freispruch für den Hund der Baskervilles. Hier irrte Sherlock Holmes« (»L’affaire du chien des Baskervilles«).
»Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat«
Dies ist kein Ratgeber für Poser, die mit nichtvorhandener Bildung glänzen wollen. Bayard gibt keine Ratschläge zum Quer- oder Nichtlesen, die einem das Lesen ersparen. Im Gegenteil: Dieser äußerst charmante Essay möchte zum Lesen animieren. Er ist eine Ermutigung, den  lähmenden Respekt vor Literatur, gerade vor der sogenannten Hochliteratur abzustreifen, um einen persönlichen Zugang zu Büchern zu finden und über sie zu sprechen.
lähmenden Respekt vor Literatur, gerade vor der sogenannten Hochliteratur abzustreifen, um einen persönlichen Zugang zu Büchern zu finden und über sie zu sprechen.
Vor allem sollte man sich von der Vorstellung befreien, Bücher verfügten über festgelegte Inhalte. Mitnichten: Sie wandeln sich mit jeder Lektüre und mit jedem Gespräch über sie, denn Bücher sind weniger fixe Texte als vielmehr Gesprächsituationen. Alte rezeptionsästhetische Maxime: Ein Buch existiert nur im Diskurs. Und was heißt überhaupt »lesen«? Jeder Leser erkennt etwas anderes im Text, und im Gespräch darüber erinnert man sich nur an Bruchstücke, aus denen man einen eigenen Zusammenhang konstruiert. Lesen und Sprechen über das Gelesene sind schöpferische Akte:
So sind die Bücher, über die wir sprechen, nicht nur reale Gegenstände, die durch eine imaginäre vollständige Lektüre in ihrer objektiven Materialität wieder aufgefunden werden können, sondern immer auch Phantombücher, die am Kreuzungspunkt der unvollendeten Möglichkeiten jedes Buches und unseres Unbewussten in Erscheinung treten und unsere Träume und Gespräche mit Sicherheit noch mehr anregen als die realen Gegenstände, aus denen sie rein theoretisch hervorgegangen sind.
Und manche Bücher braucht man gar nicht gelesen zu haben, um zu wissen, was in ihnen steht, und um über sie sprechen zu können: »Hamlet«, Dan Browns »DaVinci Code«, die Harry-Potter-Bücher, James Joyce‘ »Ulysses« – Eindrücke von ihnen hat nahezu jeder. Viel zentraler ist es, sie im Verhältnis zu anderen Bücher einordnen zu können.
Pierre Bayard macht Mut zu einem unbeschwerten und sehr persönlichen Umgang mit Literatur. Bücher sind keine toten Säulenheiligen, sondern – schließlich ist Bayard auch Psychoanalytiker – Instrumente der Selbsterkenntnis. Das Eigene im Buch zu finden, über das Buch zu sprechen, um über sich zu sprechen – das ist ihm wichtig.
Diese Aufforderung zum kreativen Herangehen an Literatur ist mit so leichter Hand, so elegant, intelligent und witzig geschrieben, mit Beispielen von Musils »Mann ohne Eigenschaften«, Umberto Ecos »Der Name der Rose«, mit Shakespeare, Balzac, Oscar Wilde, David Lodge oder auch Filmen wie »Und täglich grüßt das Murmeltier« untermauert, dass man gar nicht merkt, dass dies eigentlich ein literaturwissenschaftlicher Essay ist, in dem unter anderem eine Theorie des Lesens entworfen wird.
»Freispruch für den Hund der Baskervilles. Hier irrte Sherlock Holmes«
Wurde in »Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat« die Literatur vom Sockel geschubst, sind es im zweiten Buch die Autoren, die ihres halb genialischen Nimbus entledigt werden. Bayard wählt dafür einen der bekanntesten Romane von Arthur Conan Doyle:  Mindestens 24 Mal wurde »Der Hund der Baskervilles« verfilmt, unvergessen die musikalische Interpretation von Cindy und Bert 1970 unter Verwendung von »Paranoid« von Black Sabbath (das »Video« mit Großaufnahmen eines Mopses, wahrhaft spooky). Anhand dieser Geschichte demonstriert Bayard das, was er »Kriminalkritik« nennt:
Mindestens 24 Mal wurde »Der Hund der Baskervilles« verfilmt, unvergessen die musikalische Interpretation von Cindy und Bert 1970 unter Verwendung von »Paranoid« von Black Sabbath (das »Video« mit Großaufnahmen eines Mopses, wahrhaft spooky). Anhand dieser Geschichte demonstriert Bayard das, was er »Kriminalkritik« nennt:
In der Tat ist der wesentliche Unterschied, der die Kriminalkritik nicht nur von anderen Arbeiten zur Kriminalliteratur, sondern von der Literaturkritik insgesamt trennt, ihr Interventionismus. Während die anderen Methoden sich meist damit zufrieden geben, die Texte – ungeachtet der Skandale, die sich in ihnen abspielen – passiv zu kommentieren, lässt sich die Kriminalkritik nicht von der offiziellen Version vereinnahmen und mischt sich aktiv ein. Sie bringt nicht nur die Schwächen der Texte ans Tageslicht und weckt Zweifel an den vorgeblichen Mördern, sondern zieht auch couragiert die Konsequenzen daraus und spürt den wahren Verbrecher auf.
Schritt für Schritt weist Bayard die Lücken und Fehler in Holmes Methode und Ermittlung auf. Aber nicht nur das: Er kann auch zeigen, dass sich hinter dem Fall, den Conan Doyle erzählt – und der unter dieser Betrachtungsweise kein Kriminalfall mehr ist -, eine ganz andere Geschichte versteckt, ein ungemein perfider und teuflischer Mord, der bis heute literarisch ungesühnt ist. Begangen von einem Täter, der im Buch vollkommen unschuldig erscheint – das will es uns zumindest der Autor weismachen.
Das ist möglich, weil Bücher nicht im luftleeren Raum entstehen. Autoren entwerfen (notwendigerweise) lückenhafte Welten, beeinflusst von der eigenen Realitätssicht und den persönlichen Komplexen. Bücher sind keine in sich geschlossenen Universen, sondern offene Systeme, die vieles von dem widerspiegeln, was die Autoren umtreibt – bewusst und unbewusst. Von dem Eigenleben, das Figuren und Welten außerdem entwickeln, mal ganz abgesehen. Darum lässt sich in Texten eine Menge finden, was ihr Schöpfer gar nicht beabsichtigt hat.
Autoren mögen beim Schreiben eine Absicht verfolgen – ihr Text hat oft eine andere. Bayard hat dies schon an Agatha Christies »The Murder of Roger Ackroyd« (deutsch »Alibi«; Pierre Bayard: »Qui a tué Roger Ackroyd«, 1998) und an Shakespeares »Hamlet« (Pierre Bayard: »Enquête sur Hamlet. Le Dialogue de sourds«, 2002) gezeigt. Arbeiten von Sandor Goodhardt oder Shoshana Felman weisen auf Widersprüche in »Ödipus Rex« von Sophokles hin.
Bücher sagen nicht die Wahrheit, sie verströmen keine Weltweisheit. Als Leser ist man darum gut beraten, mit wachem Verstand und kritischem Blick zu betrachten, was der Autor einem als bare Münze zu verkaufen trachtet. Lieber selbst denken, als es einem Fremden zu überlassen.
Wider die Verehrungsstarre
Mit seinen Schriften plädiert Bayard für eine Entsakralisierung von Literatur. Bücher sind nicht von sich aus wertvoll oder wahr, sondern gewinnen ihre Bedeutung erst in der Auseinandersetzung mit ihnen – und das jedes Mal neu. Man sollte ihnen darum nicht mit lähmenden Respekt oder einer Verehrungsstarre begegnen. Denn das ist der Tod der Literatur.
 Pierre Bayard: Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat
Pierre Bayard: Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat
Aus dem Französischen von Lis Künzli
Verlag Antje Kunstmann 2007
geb., 220 Seiten, 16,90 Euro
ISBN: 978-3-88897-486-1
auch erhältlich als eBook (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch-Download (hier klicken)
 Pierre Bayard: Freispruch für den Hund der Baskervilles.
Pierre Bayard: Freispruch für den Hund der Baskervilles.
Hier irrte Sherlock Holmes
Aus dem Französischen von Lis Künzli
Verlag Antje Kunstmann 2008
Leicht gekürzte Fassung
geb., 205 Seiten, 16,90 Euro
ISBN: 978-3-88897-529-5
Diese Rezension ist auch erschienen auf satt.org