»Der Sturm« im Wasserglas
Eigentlich möchte Albert Crosetti an der Filmakademie der Universität New York studieren. Weil dem 28-Jährigen aber das Geld dafür fehlt, jobbt er in Midtown Manhattan in einem Antiquariat. Durch Zufall entdeckt er im Einband eines alten Buches mehrere Briefe. Offenbar stammen sie  aus dem 17. Jahrhundert, verfasst von einem Mann namens Bracegirdle, der behauptet, im Auftrag der damaligen britischen Regierung William Shakespeare ausspioniert zu haben. Die Mehrzahl der Briefe ist chiffriert. Enthalten sie vielleicht die Berichte, die Bracegirdle seinen Auftraggebern sandte?
aus dem 17. Jahrhundert, verfasst von einem Mann namens Bracegirdle, der behauptet, im Auftrag der damaligen britischen Regierung William Shakespeare ausspioniert zu haben. Die Mehrzahl der Briefe ist chiffriert. Enthalten sie vielleicht die Berichte, die Bracegirdle seinen Auftraggebern sandte?
Auf Anraten seiner Kollegin Carolyn – seinem heimlichen Schwarm – überlässt Albert einen Brief dem Shakespeare-Experten Prof. Bulstrode. Zu einem lächerlichen Preis, wie er im Nachhinein feststellt. Denn die alten Dokumente bergen das Potenzial, die Shakespeare-Forschung von Grund auf zu revolutionieren. Und was noch entscheidender ist: Sie enthalten einen Hinweis auf ein bislang unbekanntes Theaterstück von Shakespeare, womöglich erhalten in seiner eigenen Handschrift. Dieses Manuskript – wenn es denn tatsächlich existiert – wäre das vermutlich wertvollste Schriftstück der Welt.
Eine solche potenzielle Sensation zieht natürlich Kreise: Selbst die Russenmafia ist auf einmal hinter den Briefen her, Professor Bulstrode wird zu Tode gefoltert – und Albert findet sich in Begleitung des etwas dubiosen Anwalts Jake Mishkin auf der Jagd nach weiteren Hinweisen auf dem Weg zum Manuskript.
Limbo statt Stabhochsprung
»Der Name der Rose« von Umberto Eco und »Sakrileg« beziehungsweise der »Da Vinci Code« von Dan Brown dürften im Hinterkopf des Autors Michael Gruber Quartier bezogen haben. Ist ja auch eine schöne Idee: ein intelligentes Puzzle nicht im Vatikan-, sondern im Literaturmilieu, nicht im Mittelalter, sondern im Heute spielend. Mit Eco und Brown ist eine recht ausgedehnte Niveau- und Gestaltungsspannbreite aufgezogen, dazu noch Shakespeare, der mit seiner ihm zugewiesenen Zentralstellung unweigerlich als Vergleich mitschwingt – damit ist die Messlatte auf einer Höhe eingehängt, die nicht so leicht zu überspringen ist. Gruber rauscht dementsprechend auf halber Höhe unten durch.
Seine Jagd nach dem alten Manuskript ist – trotz des ermordeten Professors – überwiegend harmlos-heiter. Manches erinnert an ein Possenspiel – der Anwalt mit seiner bühnenreifen Familie und dem eigenwilligen familiären Experiment zum Beispiel; dazu kommen ein oder zwei Femmes fatales; den Chef der Russenmafia umgibt ein Hauch Mephistopheles; schließlich noch ein paar schräge Figuren aus der Literaturbranche – und schon ist ein buntes Bühnenensemble beisammen. Da wir uns aber im 21. Jahrhundert befinden, wird der Verweis aufs Theater offenbar als nicht mehr zeitgemäß angesehen: Stattdessen gibt es Filmzitate und Hinweise auf Filmtechniken. Vielleicht fürchtet der Autor, dass Zitate aus der Theaterwelt vom heutigen Lesepublikum nicht mehr verstanden werden – oder er kennt sich selbst damit nicht aus.
Kleinbürgertum statt Mysterium
Hätte er sich mal selbst an seine Filmperspektive gehalten. Hätte er sich als Messlatte lieber »Shakespeare in Love« gewählt, als ausgerechnet auf den »Sturm« anzuspielen. Sich mit einem Meister in Sachen Vieldeutigkeit messen zu wollen – da darf man nicht auf Eindeutigkeiten herumkrabbeln. Grubers Figuren sind zwar im ersten Moment charakterlich nicht ganz klar einzuordnen – aber letztlich reicht ein zweiter Blick, um festzustellen, dass alle miteinander herzensgut sind. Keinerlei Ambivalenzen, nirgendwo. Auch der Plot, erst recht das mysteriöse Manuskript und seine Existenz lassen keinen Raum für Spekulationen. Es ist sogar vorgezeichnet, wie das unbekannte Drama zu interpretieren ist.
Nicht einmal Shakespeare selbst wird seine Uneindeutigkeit als Person und Dramatiker belassen. Was bei »Shakespeare in Love« als pure Phantasie Charme entfalten konnte, wird hier in Ernsthaftigkeit ausgebreitet: So stellt sich also Gruber den echten Shakespeare vor – bis hin zu Haushaltsführung und Religiosität. Alles, einfach alles wird ausgedeutet und vorhersehbar auf festen Boden geschubst. Komplett entzaubert. Das »Mysterium Shakespeare« (Grubers eigene Worte) zum Kleinbürger gestutzt. Spätestens da ist klar, dass sich die ganze Geschichte in Belanglosigkeit verliert. Wenn am Ende dann jeder Topf seinen Deckel findet und jedem Gerechtigkeit und Wohlstand widerfährt, ist unbezweifelbar: Hier gibt es kein Spiel, keine Doppelbödigkeit, keine Tiefe, sondern – bei aller Farbigkeit – nur mickrige Banalitäten. Nicht mal für ’ne Luftnummer hat’s gereicht.
 Michael Gruber: Shakespeares Labyrinth
Michael Gruber: Shakespeares Labyrinth
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Seeberger
Aufbau Verlag 2009
HC, 583 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-351-03233-3
Diese Rezension ist auch erschienen auf satt.org
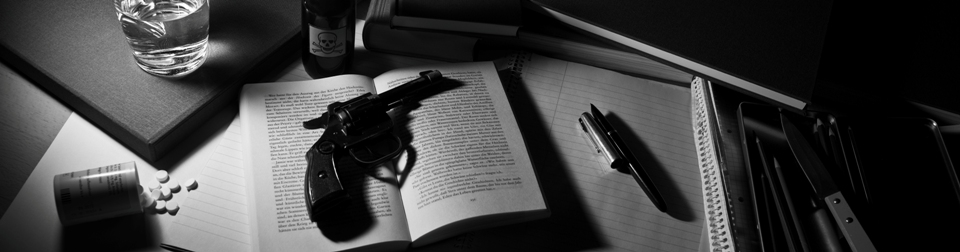
 In Berlin. Aber dennoch muss ja Geld hereinkommen, Gelegenheitsjobs befriedigen auf Dauer nicht. Also gründen die vier Freunde eine Agentur, die einen sehr eigenen Service anbietet.
In Berlin. Aber dennoch muss ja Geld hereinkommen, Gelegenheitsjobs befriedigen auf Dauer nicht. Also gründen die vier Freunde eine Agentur, die einen sehr eigenen Service anbietet.
 ebenso tristen Industriestadt Wedersen.
ebenso tristen Industriestadt Wedersen. eines Einbruchs, der entwendete Laptop der Sozialarbeiterin und verschiedene andere Dinge werfen mehr und mehr Fragen auf. Was so klar begann, wird immer verworrener.
eines Einbruchs, der entwendete Laptop der Sozialarbeiterin und verschiedene andere Dinge werfen mehr und mehr Fragen auf. Was so klar begann, wird immer verworrener.