Für die »Polente Bremen« auf der Spur des Verbrechens
Dank wohlmeinender Verwandte (»Du liest doch so gern Krimis, da dachten wir, das gefällt dir bestimmt …«) war ich im Besitz eines Gutscheins für den Straßenkrimi in Bremen. Ein Mitmachkrimi. Danke. Auf der Homepage des Veranstalters hatte ich die Wahl zwischen zwei Fällen in der Bremer Innenstadt: »Tod einer Hausfrau« und »Der Baulöwe hat ausgebrüllt«. Ich wählte ersteres. Wenige Tage später ging es los.
Gedanklich stellte ich mich ein auf einen Nachmittag mit Menschen in Polyesterhosen und gesunden Schuhen jenseits des 68. Lebensjahres, die einander als »flott angezogen« bezeichneten. Wahrscheinlich bevorzugten sie humorlose skandinavische Grübler oder Commissarios in Postkartenkulisse. Und mit denen würde ich dann die touristischen Highlights von Bremen abklappern und dabei einen »Fall« »lösen«, der total einfach zu durchschauen ist. (Sorry, manchmal sind meine Vorurteile schneller als ich.)
Soko »Schlafmütze« meldet sich zum Dienst
Schließlich ist es so weit: ein wunderbar sonniger Sonntagnachmittag. Die erste Überraschung erwartet mich, als ich um die Ecke zum Sammelplatz biege – stilecht kurz neben einer Polizeiwache und ganz in der Nähe der Staatsanwaltschaft: Ich bin die Älteste! Alle anderen sind Ende zwanzig, knapp Anfang dreißig. Niemand trägt Polyesterhosen (ich auch nicht).
Heiko Sakel, Geschäftsführer der Agentur für Kriminalspiele, die die Straßenkrimis in Bremen, Oldenburg, Hannover und Nürnberg organisiert, berichtet später im Interview, das Gros der Teilnehmer sei zwischen 25 und 50. Und eher Frauen als Männer. Aber richtig statistisch erfasst sei das nicht, es sind eher Schätzwerte. Meine Erfahrungen dieses Nachmittags bestätigen dies: Wir sind zu sechst, vier Frauen, zwei Männer, und alle im Alter zwischen 28 und 42.
Soko »Schlafmütze«, so nennen wir uns an jenem Sonntagnachmittag (Fragen Sie nicht …). Bevor es losgeht, führt uns unser »Vorgesetzter« in den Fall ein: Eine 24-jährige Hausfrau wurde erschlagen in einer dunklen Gasse Bremens aufgefunden. Im Anschluss erhalten wir eine Tasche mit Ermittlungsunterlagen und Equipment: Obduktionsbericht, Protokolle von Zeugenaussagen, ein detaillierter Stadtplan, Handschellen und ein Handy. Dazu Dienstausweise und Visitenkarten. Und die ausdrückliche Instruktion, über jeden unserer Schritte telefonisch Bericht zu erstatten. Verhaften dürfen wir nur jemanden, wenn wir vorher bei unserem Chef angerufen haben und der via Staatsanwaltschaft beim Richter einen Haftbefehl beantragt hat.
Die Unterlagen sind wirklich liebevoll und mit Blick fürs Detail ausgearbeitet, der korrekte Dienstweg wird eingehalten, und auf unseren Ausweisen steht »Polente Bremen«.
Falsche Fährten, unzuverlässige Zeugen – so richtig einfach ist das nicht
Dann geht’s los. Zum Glück kommt noch jemand auf die Idee, nach der Telefonnummer des Ehemanns des Opfers zu fragen, sonst hätten wir überhaupt nicht gewusst, was wir nun anstellen sollen. Das ist die zweite Überraschung: So richtig einfach ist das nicht, und wirklich viel wird uns zunächst nicht an die Hand gegeben. Wir müssen selbst überlegen, wie wir vorgehen. So laufen wir aufgeregt kichernd und spekulierend durch Bremen, befragen Zeugen, mit denen wir vorher telefonisch Treffpunkte ausgemacht haben und versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen.
Doch das gelingt uns nur mäßig erfolgreich, denn es gibt falsche Fährten, die Zeugen erzählen eine Menge, wenn man sie eine Menge fragt, und manchmal lügen sie auch. Am Ende haben wir zwei Verdächtige und können uns nicht entscheiden.
Kommt das oft vor, dass Ermittler nicht weiter wissen, will ich im Interview wissen. Sakel gibt sich bedeckt, vielleicht um die Soko »Schlafmütze« nicht zu kompromittieren. Es komme durchaus mitunter vor. Und was geschieht dann? Gibt es Möglichkeiten, den Ermittlern auf die Sprünge zu helfen? Die gibt es durchaus: Schließlich berichten das Ermittlerteam ja immer per Handy vom Stand der Dinge. Auch die Zeugen stehen mit den Organisatoren telefonisch in Kontakt und werden dann im Notfall angewiesen, den Ermittlern zügig die notwendigsten Informationen mitzuteilen oder – falls die Ermittler zu fix sind – sie etwas hinzuhalten. Und wenn die Ermittler gar nicht wissen, was sie tun sollen? »Es gibt natürlich ein paar Tricks, wie man unterstützend tätig werden kann«, erklärt Sakel, ohne sich in die Karten schauen zu lassen.
Wenn die Fiktion zu echt wirkt
Im Fall der Soko »Schlafmütze« funktioniert es: Wir nehmen am Ende eine Verhaftung vor – und offenbar sogar die richtige. Das geht bei uns halbwegs glimpflich ab. Manche Teams haben da schon ganz andere Erfahrungen gemacht, berichtet Heiko Sakel: »Zweimal haben wir einen Polizeieinsatz ausgelöst. Einmal kamen zwei Beamte, einmal sogar acht. Die Verhaftungen haben so echt gewirkt, dass Passanten dachten, sie rufen lieber mal die Polizei.« Einmal ist sogar eine unbeteiligte Passantin auf einen Zeugen mit dem Regenschirm losgegangen, erzählt Sakel: »Beim Fall ›Der Baulöwe hat ausgebrüllt‹ wird ein Zeuge an einer Stelle etwas lauter. Der Darsteller war in seiner Rolle sehr überzeugend, und offenbar hat die Passantin gedacht, da muss sie eingreifen. Das ist ja eigentlich ein Glück, dass Menschen sich in solchen Fällen einsetzen und einmischen.«
Auch an diesem Sonntag sind die Darsteller wirklich sehr engagiert und überzeugend. Rollenadäquat beantworten sie auch die merkwürdigste Frage der Ermittler und fallen kein einziges Mal aus dem Spiel heraus, während wir Kommissare mitunter vor Kichern kaum weiterkommen. Pro Fall sind sechs bis sieben Darsteller dabei, die wenigsten von ihnen haben Schauspielerfahrung, die meisten sind über Kleinanzeigen dazugekommen oder haben eine Tour als Ermittler mitgemacht und sind dann als Zeugen dabeigeblieben. Fehlende berufliche Professionalität machen sie mit großer Spielfreude wett.
Abseits der Sehenswürdigkeiten an den Vorurteilen vorbei
Und die Fälle? Woher kommen die? »Das sind alles eigene Stücke«, sagt Heiko Sakel – ursprünglich Diplom-Kaufmann mit Studium der Tourismuswirtschaft. »Zwei habe ich geschrieben, und eins, der ›Tod einer Hausfrau‹, ist von einer Darstellerkollegin.« Neue Fälle werden zunächst in Oldenburg angeboten: »Da ist meine Homebase sozusagen und damit auch die Teststrecke«, erklärt Sakel. Zunächst wird anhand der Praxiserfahrung noch nachgebessert, denn »man kann gar nicht auf alles vorbereitet sein, was passieren kann, das hat eh alles viel mit Improvisation zu tun«. Und wenn’s gut läuft, gehen die Fälle auch an andere Städte. So zum Beispiel »Der Fall Chagall«, den es bislang nur in Oldenburg gibt, der soll im Laufe dieses Jahres auch in Bremen, Hannover und Nürnberg angeboten werden. Warum eigentlich dieser Schlenker in den Süden? »Nürnberg hat zwei Gründe«, erläutert Sakel: »Zum einen habe ich da ein paar Jahre gewohnt, dadurch kenne ich die Stadt ein bisschen. Und zum anderen lebt meine Schwester da und betreut das Ganze vor Ort.«
Dieses Vorgehen erklärt etwas, das mir erst nach Aufklärung des »Todes einer Hausfrau« auffällt: In den drei Stunden, die wir unterwegs waren, haben wir keine einzige Sehenswürdigkeit zu Gesicht bekommen. »Es gibt in Bremen auch Routen, die durchaus durch die Touristenviertel führen, durchs Schnoorviertel zum Beispiel oder durchs Ostertorviertel«, erklärt Sakel, aber die Fälle sind so aufgebaut, dass sie auch auf anderen Routen funktionieren – »falls in der Innenstadt etwas los ist: Christopher Street Day, der Umzug der Kulturen oder die Chaostage in Hannover« -, damit man ausweichen kann und die Fälle sich auch in andere Städten übertragen lassen.
Seit 2006 bietet Sakel die Straßenkrimis in Oldenburg an, seit 2007 in Bremen. Aus der Anfangszeit stammt noch die Bezeichnung als »Agentur für Kriminalspiele«. So ganz stimmt der Titel im Moment nicht, denn »wir bieten ja keine fremden Produkte an, sondern nur unsere eigenen«. Für die Zukunft sind weitere Sachen angedacht, nicht nur neue Fälle, aber Sakel hält sich bedeckt, wenn es um Einzelheiten geht: »Das ist alles noch nicht spruchreif.«
Meine Vorurteile sind an diesem Tag samt und sonders nicht bedient worden – stattdessen war es ein unerwartet vergnüglicher Nachmittag mit einem gut durchdachten und in der Tat nicht leicht zu durchschauenden Fall und wirklich überzeugenden Darstellern.
Kirsten Reimers
www.strassenkrimi.de
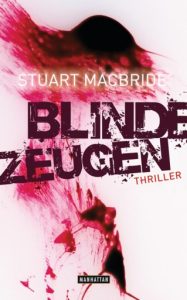 Stadt nur umso deutlicher hervortreten. Und auch Detective Sergeant Logan McRaes Gemüts- verfassung steht im deutlichen Gegensatz zum schönen Wetter: Seit der Serienmörder- jagd im letzten Krimi – »Blut und Knochen« (2009) – aus nur zu verständlichem Grund Vegetarier, von Schlaflosigkeit geplagt, überfallen ihn sogar tagsüber Alpträume und Panikattacken. Am liebsten würde er sich nur noch betrinken, um nichts mehr zu spüren. Der einzige Lichtblick in diesem Sommer ist die Stelle eines Detective Inspector, die es neu zu besetzen gilt. McRae hat durchaus Chancen auf diese Beförderung – wenn er nicht allzu viel Mist baut.
Stadt nur umso deutlicher hervortreten. Und auch Detective Sergeant Logan McRaes Gemüts- verfassung steht im deutlichen Gegensatz zum schönen Wetter: Seit der Serienmörder- jagd im letzten Krimi – »Blut und Knochen« (2009) – aus nur zu verständlichem Grund Vegetarier, von Schlaflosigkeit geplagt, überfallen ihn sogar tagsüber Alpträume und Panikattacken. Am liebsten würde er sich nur noch betrinken, um nichts mehr zu spüren. Der einzige Lichtblick in diesem Sommer ist die Stelle eines Detective Inspector, die es neu zu besetzen gilt. McRae hat durchaus Chancen auf diese Beförderung – wenn er nicht allzu viel Mist baut.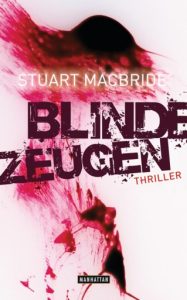 Stuart MacBride: Blinde Zeugen
Stuart MacBride: Blinde Zeugen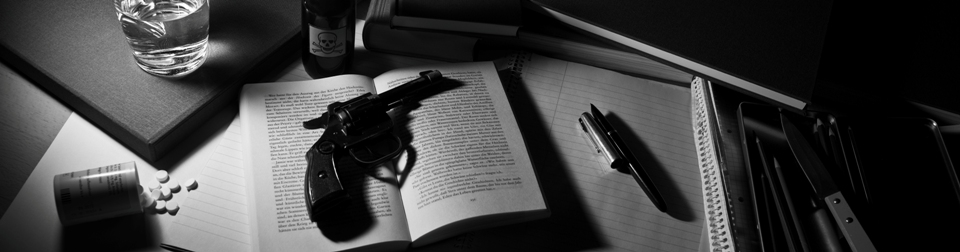
 de Médecine Légale in Montréal tätig. Das spiegelt sich in ihren Krimis wider: Reichs weiß, wovon sie schreibt. Eher unaufgeregt als bluttriefend, sind ihre Beschreibungen von Obduktionen, Knochenanalysen oder Gewebeextraktionen eine detailreiche, aber dennoch meist unterhaltsame Lehrstunde in Anatomie, Forensik, Anthropologie und und und. In ihre Romane fließen Fälle ein, an denen sie mitgearbeitet hat, das macht es oft sehr lebensnah mit einem guten Blick für Zusammenhänge und Hintergründe.
de Médecine Légale in Montréal tätig. Das spiegelt sich in ihren Krimis wider: Reichs weiß, wovon sie schreibt. Eher unaufgeregt als bluttriefend, sind ihre Beschreibungen von Obduktionen, Knochenanalysen oder Gewebeextraktionen eine detailreiche, aber dennoch meist unterhaltsame Lehrstunde in Anatomie, Forensik, Anthropologie und und und. In ihre Romane fließen Fälle ein, an denen sie mitgearbeitet hat, das macht es oft sehr lebensnah mit einem guten Blick für Zusammenhänge und Hintergründe. bei der Rettung der Frau die DNA-Spuren beseitigen (müssen), kann die Tat keinem der Familienväter zweifelsfrei zugeordnet werden. Die Vergewaltiger gehen straffrei aus, es kommt nicht einmal zum Prozess. Der Erzähler, ein sehr junger Strafrechtanwalt, ist der Verteidiger eines der Täter; er muss sich eingestehen, dass er mit diesem Mandat seine Unschuld verloren hat.
bei der Rettung der Frau die DNA-Spuren beseitigen (müssen), kann die Tat keinem der Familienväter zweifelsfrei zugeordnet werden. Die Vergewaltiger gehen straffrei aus, es kommt nicht einmal zum Prozess. Der Erzähler, ein sehr junger Strafrechtanwalt, ist der Verteidiger eines der Täter; er muss sich eingestehen, dass er mit diesem Mandat seine Unschuld verloren hat. Schwüle Sommerhitze über Hamburg und Leichenteile in der Elbe. Aber nur Köpfe, Hände, Füße – alles männlich -, der Rest ist weg. Wer in den achtziger Jahren die ersten richtig fiesen »Frauenkrimis« gelesen hat, weiß nach genau zwei Seiten, worauf das hinausläuft. Die ermittelnden Beamten und mit ihnen die Staatsanwältin Chastity Riley brauchen deutlich länger, aber immerhin auch nur 250 Seiten. Zumindest bleibt der Umfang übersichtlich.
Schwüle Sommerhitze über Hamburg und Leichenteile in der Elbe. Aber nur Köpfe, Hände, Füße – alles männlich -, der Rest ist weg. Wer in den achtziger Jahren die ersten richtig fiesen »Frauenkrimis« gelesen hat, weiß nach genau zwei Seiten, worauf das hinausläuft. Die ermittelnden Beamten und mit ihnen die Staatsanwältin Chastity Riley brauchen deutlich länger, aber immerhin auch nur 250 Seiten. Zumindest bleibt der Umfang übersichtlich.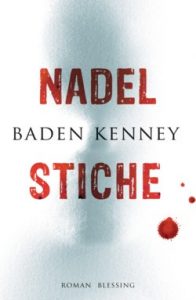 Menschen sterben, wird der Pathologe Jake Rosen – mittelalt, attraktiv, brillanter Wissenschaftler, aber vollkommen unorganisiert im Alltagsleben – hinzugezogen. Ein zweiter Fall, der – so ein Zufall aber auch! – unerwarteterweise mit den Blutzapfkram zusammenhängt, bringt auch Rosens Freundin, die Anwältin Philomena »Manny« Manfreda – jung, hübsch, rotlockige Mähne, mit Vorliebe für Manolo Blahniks – ins Spiel.
Menschen sterben, wird der Pathologe Jake Rosen – mittelalt, attraktiv, brillanter Wissenschaftler, aber vollkommen unorganisiert im Alltagsleben – hinzugezogen. Ein zweiter Fall, der – so ein Zufall aber auch! – unerwarteterweise mit den Blutzapfkram zusammenhängt, bringt auch Rosens Freundin, die Anwältin Philomena »Manny« Manfreda – jung, hübsch, rotlockige Mähne, mit Vorliebe für Manolo Blahniks – ins Spiel.