Hosenträgerträger statt Haudrauf
Malcolm Fox ist der Neue von Ian Rankin. Anfang vierzig, geschieden, ein wenig schwerfällig, trägt Fliege und Hosenträger. Er trinkt keinen Alkohol, raucht nicht und hört Birdradio – einen Sender, der nur Vogelstimmen bringt. Und anders als sein Vorgänger John Rebus arbeitet er bei  der internen Ermittlung.
der internen Ermittlung.
Complaints and Conduct hieß ihre Abteilung offiziell. Sie waren die Polizisten, die gegen andere Polizisten ermittelten. Die »Leisetreter«, die »Schleicherbrigarde«. Innerhalb der Abteilung gab es eine Unterabteilung – die Professional Standards Unit. Während Complanits and Conduct die bodenständigen Fälle bearbeitete – Beschwerden über Streifenwagen, die auf Behindertenparkplätzen standen, oder Polizisten in der Nachbarschaft, die zu laut Musik hörten -, galt die PSU zuweilen als »die dunkle Seite«. Ihre Ermittler spürten Rassismus und Korruption auf. Sie befassten sich mit Fällen, in denen Schmiergelder kassiert oder beide Augen zugedrückt worden waren. Sie gingen geräuschlos vor und verfügten über so viel Macht, wie sie brauchten, um ihre Arbeit zu erledigen. Fox und sein Team gehörten zu PSU.
Ganz so langweilig und behäbig, wie man im ersten Moment meinen könnte, ist der Neue allerdings nicht. Gerade hat Fox die Ermittlungen zu korrupten Kollegen abgeschlossen, als er von der Abteilung CEOP, dem Kinderschutz, um Mithilfe gebeten wird: Ein Polizeibeamter – Jamie Brecks – wird verdächtigt, einem Pädophilennetzwerk anzugehören. Kaum hat Fox erste Informationen eingeholt, wird der schlägernde Freund seiner Schwester Jude tot aufgefunden, offenbar ermordet, kurz nachdem er Jude den Arm gebrochen hat. Und ausgerechnet Jamie Brecks führt die Ermittlungen. Fox hat nun mehr mit Brecks zu tun, als ihm lieb ist – und er muss zudem feststellen, dass ihm der andere sympathisch ist. Je näher er ihn kennenlernt, umso mehr zweifelt Fox an dem Vorwurf der Pädophilie. Brecks andererseits bezieht den Älteren über Gebühr in die Suche nach dem Mörder seines Fast-Schwagers ein. Als dies auffliegt, werden beide vom Dienst suspendiert. Ganz offenbar wurde ihnen eine Falle gestellt. Gemeinsam beginnen sie zu ermitteln und stoßen auf ein Netz aus Korruption und Verrat, das seine Fäden bis in Stadtverwaltung und die Polizei spannt.
Rankin inszeniert seinen Polizeikrimi vor dem Hintergrund der geplatzten Immobilienblase des Herbst und Winters 2008 und 2009. Komplex und gut durchdacht, hat jedes Geschehen, jedes Ereignis seinen Platz und seine Bedeutung. Mit hoher Könnerschaft verwebt Rankin seine Fäden zu einem vielschichtigen Ganzen, zu dem das zurückhaltende Tempo, das er anschlägt, hervorragend passt.
 Ian Rankin: Ein reines Gewissen
Ian Rankin: Ein reines Gewissen
(The Complaints, 2009)
Aus dem Englischen von Juliane Gräbener-Müller
Manhattan 2010
geb., 512 Seiten, 19,95 Euro
ISBN 978-3-442-54650-3
auch erhältlich als eBook (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch-Download (hier klicken)
Diese Besprechung ist auch erschienen auf satt.org
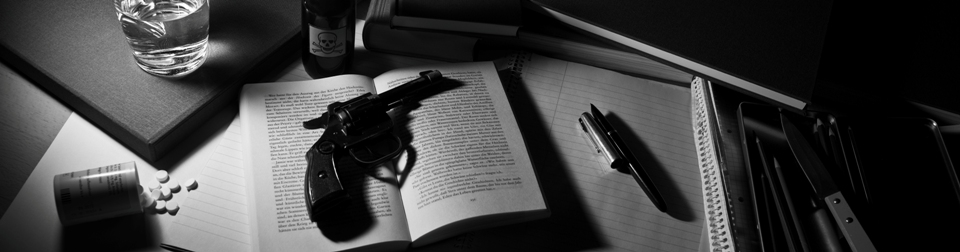
 Präsidenten führt, ragt ein mumifizierter Arm. Schuld daran ist ein Steinschlag: Die Villa des laotischen Staats- oberhaupts liegt vor einer der Höhlen, in denen sich die Anhänger der kom- munistischen Partei während des Vietnam- krieges verbargen. Von hier aus organisierten sie den Widerstand und den Befreiungskampf. Tausende lebten hier, und es existierte eine regelrechte Stadt in den Höhlen unter den Karsten. Diese hatten jedem Bombenangriff der USA standgehalten, selbst dem Streuteppich der Fünfhundert-Kilo-Bomben gegen Ende des Krieges.
Präsidenten führt, ragt ein mumifizierter Arm. Schuld daran ist ein Steinschlag: Die Villa des laotischen Staats- oberhaupts liegt vor einer der Höhlen, in denen sich die Anhänger der kom- munistischen Partei während des Vietnam- krieges verbargen. Von hier aus organisierten sie den Widerstand und den Befreiungskampf. Tausende lebten hier, und es existierte eine regelrechte Stadt in den Höhlen unter den Karsten. Diese hatten jedem Bombenangriff der USA standgehalten, selbst dem Streuteppich der Fünfhundert-Kilo-Bomben gegen Ende des Krieges.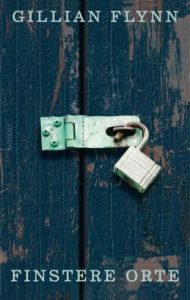 Januarnacht im Jahr 1985 seine beiden kleinen Schwestern erwürgt und mit einer Axt erschlagen, die Mutter erstochen, erschlagen und erschos- sen.
Januarnacht im Jahr 1985 seine beiden kleinen Schwestern erwürgt und mit einer Axt erschlagen, die Mutter erstochen, erschlagen und erschos- sen.
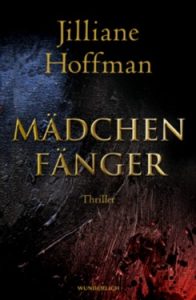 Lainey, wie das Mädchen genannt wird, lediglich bei einer Freundin untergetaucht ist und bald wieder nach Hause zurückkehrt. Dass Bobby Dees vom Crimes Against Children Squad, dem Dezernat für Verbrechen an Kindern, hinzugerufen wird, ist eine reine Formsache, denn Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. Nur ein ungutes Gefühl – und allein aus diesem Grund gräbt Dees ein wenig tiefer. Tatsächlich stößt er auch auf Ungereimtheiten, und wenig später wird es mit Macht offensichtlich: In Miami und Umgebung geht ein Serienmörder um, der es offenbar auf junge Ausreißerinnen abgesehen hat (im Original heißt das Buch »Pretty Little Things«, erschienen 2010).
Lainey, wie das Mädchen genannt wird, lediglich bei einer Freundin untergetaucht ist und bald wieder nach Hause zurückkehrt. Dass Bobby Dees vom Crimes Against Children Squad, dem Dezernat für Verbrechen an Kindern, hinzugerufen wird, ist eine reine Formsache, denn Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. Nur ein ungutes Gefühl – und allein aus diesem Grund gräbt Dees ein wenig tiefer. Tatsächlich stößt er auch auf Ungereimtheiten, und wenig später wird es mit Macht offensichtlich: In Miami und Umgebung geht ein Serienmörder um, der es offenbar auf junge Ausreißerinnen abgesehen hat (im Original heißt das Buch »Pretty Little Things«, erschienen 2010).