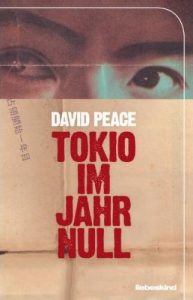Der Preis der Geborgenheit
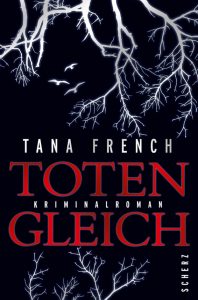 In einem heruntergekommenen Cottage wird eine junge Frau erstochen aufgefunden. Sie scheint Detective Cassie Maddox wie aus dem Gesicht geschnitten. Und damit nicht genug, sie trägt einen Namen, den Maddox vor Jahren als Undercoveragentin benutzt hatte, um sich in einen Drogendealerring einzuschleusen. Eine fiktive Identität, die sich offenbar jene Tote zunutze gemacht hat.
In einem heruntergekommenen Cottage wird eine junge Frau erstochen aufgefunden. Sie scheint Detective Cassie Maddox wie aus dem Gesicht geschnitten. Und damit nicht genug, sie trägt einen Namen, den Maddox vor Jahren als Undercoveragentin benutzt hatte, um sich in einen Drogendealerring einzuschleusen. Eine fiktive Identität, die sich offenbar jene Tote zunutze gemacht hat.
Dies ist Lexie Madisons Geschichte, nicht meine. Ich würde Ihnen gern die eine erzählen, ohne in die andere hineinzugeraten, aber das funktioniert nicht. Früher dachte ich, ich hätte uns eigenhändig an den Rändern zusammengenäht, den Faden festgezurrt, und ich könnte die Naht jederzeit wieder auftrennen, ganz nach Belieben. Jetzt denke ich, dass sie schon immer tiefer reichte und weiter, dass sie unterirdisch verlief, außer Sichtweite und völlig außerhalb meiner Kontrolle.
»Es war ein Schimmer in der Luft zwischen ihnen«
Um die Umstände zu erkunden, die zum Tod der Frau geführt haben, soll Cassie Maddox erneut in die Rolle von Lexie Madison schlüpfen. Das ist heute ungleich schwerer als damals, da die Tote der Figur ein eigenes Wesen verliehen hat. Zudem lebte sie mit vier Freunden in einem Herrenhaus auf dem Land. Denen wird erklärt, die junge Frau hätte den Angriff überlebt, sie käme bald zurück. Nach intensivster Vorbereitung nimmt Cassie schließlich die Stelle der zweiten Lexie ein. Vorsichtig erkundet sie zunächst die Person, die jene andere gewesen ist, und beginnt nach und nach, die Rolle intensiver auszufüllen. Sie taucht ein in die etwas seltsame, leicht verschrobene, aber sehr warme und vertraute Gemeinschaft der Freunde und genießt eine Nähe und ein Aufgehobensein, wie sie sie bis dahin selten erlebt hat.
Es war ein Schimmer in der Luft zwischen ihnen, wie glänzende spinnwebfeine Fäden, die hin und her und raus und rein geworfen wurden, bis jede Bewegung oder jedes Wort durch die ganze Gruppe vibrierte: Rafe, der Abby ihre Zigaretten reichte, noch fast bevor sie danach suchte, Daniel, der sich mit ausgestreckten Händen umdrehte, um den Steakteller genau in der Sekunde entgegenzunehmen, in der Justin damit durch die Tür hereinkam, Sätze, die sie sich gegenseitig zuwarfen wie Spielkarten ohne auch nur die geringste Verzögerung.
Cassie ist so fasziniert von dieser Geborgenheit, dass sie versucht ist, die Seiten zu wechseln. Sie vertuscht sogar Hinweise, die ihre neuen Vertrauten verdächtig machen könnten. Und doch weiß sie, dass diese Harmonie trügen muss – jemand, entweder aus dem Haus oder aus dem Dorf, das der Hausgemeinschaft sehr ablehnend gegenübersteht, hat schließlich Lexie getötet. Im Laufe der Zeit werden die Brüche in der Idylle deutlich, die kleinen Risse unter der Oberfläche, und es wird erkennbar, welchen Preis die Freunde zahlen müssen, um diese Vertrautheit aufrechtzuerhalten.
Nuancierung statt Action
Tana French lässt sich sehr viel Zeit, die Handlung und vor allem die Charaktere zu entfalten. Vom ersten Eindruck bis zum vertrauten Kennen verändern sich die Persönlichkeiten nur um Nuancen, und doch wird aus diesen geringen Verschiebungen, aus dem besseren Verständnis der Figuren zwingend ersichtlich, warum Lexie hat sterben müssen.
Wie schon in Frenchs hervorragenden Debüt »Grabesgrün« geht es nicht um gruselig grausige Taten, die ausgeschlachtet werden, sondern um Menschen, die miteinander und mit sich selbst konfrontiert werden. In »Totengleich« (im Original passender »The Likeness«) teilen die Figuren die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach einer selbstgewählten Familie, die ihnen Rückhalt gibt, statt Leistung zu fordern. Doch im Festhalten an diesem Idyll liegt schon der Keim seiner Zerstörung. Das ist wunderbar einfühlsam geschildert. Etwas störend ist nur die leicht ungelenke Übersetzung, das ein wenig schludrige Deutsch, der eher hingehuschelte Stil.
»Totengleich« schließt direkt an »Grabesgrün« an. Das Geschehen kann aber ohne Vorkenntnisse des ersten Buches verstanden werden. Allerdings spricht überhaupt nichts dagegen, zunächst Frenchs großartiges Debüt zu lesen.
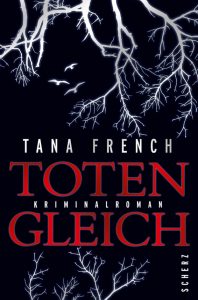 Tana French: Totengleich
Tana French: Totengleich
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Scherz 2009
geb., 780 Seiten, 16,95 Euro
ISBN: 978-3-502-10192-5
auch erhältlich als eBook (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch-Download (hier klicken)
Diese Rezension ist auch erschienen auf satt.org
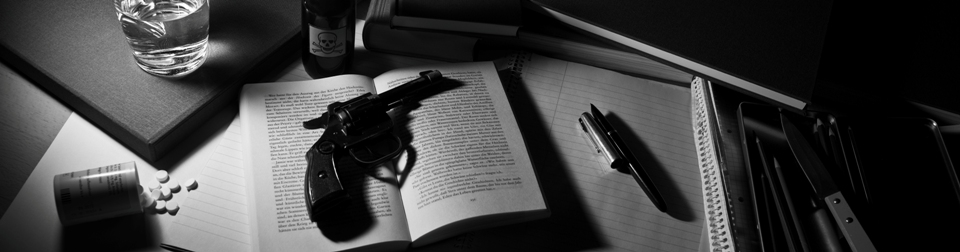
 Das hölzerne Treppenhaus war dezembernachtkalt. Und es roch nach Stressschweiß. Hier waren Leute mit aggressiven Absichten in den vierten Stock gestiegen. Ich zitterte plötzlich. Nicht vor Kälte. Denn knapp unterhalb meines bundesrepublikanischen Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit polizeilicher Maßnahmen staute sich das viel ältere Menschheitswissen von staatlicher Willkür und nächtlichen Abtransporten in Folterlager.
Das hölzerne Treppenhaus war dezembernachtkalt. Und es roch nach Stressschweiß. Hier waren Leute mit aggressiven Absichten in den vierten Stock gestiegen. Ich zitterte plötzlich. Nicht vor Kälte. Denn knapp unterhalb meines bundesrepublikanischen Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit polizeilicher Maßnahmen staute sich das viel ältere Menschheitswissen von staatlicher Willkür und nächtlichen Abtransporten in Folterlager. den Haushalt von Prinz‘ Schwester im Griff, da schreibt sie sich auch schon an der Ludwig-Maximilians-Universität ein für Anglistik und wird rasch studentische Hilfskraft bei Mara Markowski, der gerade erst berufenen Professorin für englische Literaturwissenschaft und Ehefrau des Dekans der Fakultät für Sprach- und Kulturwissenschaften.
den Haushalt von Prinz‘ Schwester im Griff, da schreibt sie sich auch schon an der Ludwig-Maximilians-Universität ein für Anglistik und wird rasch studentische Hilfskraft bei Mara Markowski, der gerade erst berufenen Professorin für englische Literaturwissenschaft und Ehefrau des Dekans der Fakultät für Sprach- und Kulturwissenschaften.