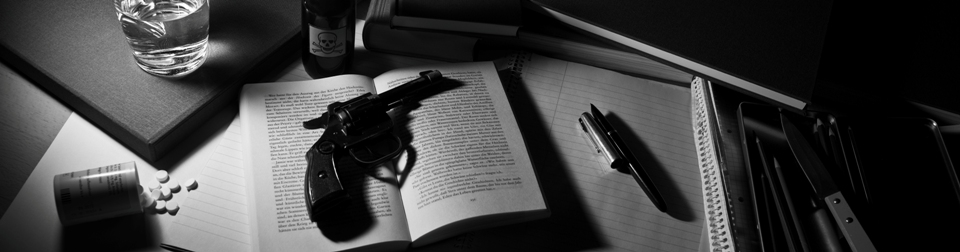Nun kann auch Henry James Superintendent Jury nicht mehr retten
Als ich das Rezensionsexemplar des aktuellen Martha-Grimes-Krimis bestellte, hatte ich schon eine Idee, wie ich die Besprechung beginnen wollte: „Einen Inspektor-Jury-Krimi zu lesen ist, wie ein Familienfest zu besuchen. Man weiß, was einen erwartet, man kennt die anderen Gäste sehr  genau, ist vertraut mit ihrer Geschichte, hat ihre Geschichten oft gehört.“ Danach wollte ich eingehen auf mein Verhältnis zu den Büchern von Grimes, dass ich die ersten Krimis, damals vor bald zwanzig Jahren, mit Freude verschlungen hatte: „Inspektor Jury schläft außer Haus“, „… spielt Domino“, „… sucht den Kensington-Smaragd“. Das war wie Agatha Christie, nur viel, viel besser. Witziger, lebendiger, moderner.
genau, ist vertraut mit ihrer Geschichte, hat ihre Geschichten oft gehört.“ Danach wollte ich eingehen auf mein Verhältnis zu den Büchern von Grimes, dass ich die ersten Krimis, damals vor bald zwanzig Jahren, mit Freude verschlungen hatte: „Inspektor Jury schläft außer Haus“, „… spielt Domino“, „… sucht den Kensington-Smaragd“. Das war wie Agatha Christie, nur viel, viel besser. Witziger, lebendiger, moderner.
In meiner Wunschrezension wollte ich ausführen, wie mich aber dann die ersten Zweifel beschlichen: die Morde so unnötig blutig, nur mäßig motiviert, die Logik stiefmütterlich behandelt – alles nur um möglichst viele Leichen möglichst schaurig in der englischen Landschaft zu drapieren. Ich wollte erzählen, wie ich mich langsam von Grimes abwandte, jahrelang kein Buch von ihr in die Hand nahm und es erst vor ein paar Jahren wieder mit ihr versuchte. Und siehe da: Es war gar nicht so schlecht. Die Morde etwas besser begründet, die Verbrechen nicht mehr so theatralisch.
Am Ende der Besprechung wollte ich wieder auf den Vergleich vom Anfang zurückkehren – ungefähr so: „Ja, Krimis von Martha Grimes zu lesen ist, wie ein Familienfest zu besuchen: Man weiß sehr genau, was passieren wird, doch man hat die anderen Gäste ins Herz geschlossen. Man ist so vertraut mit ihnen, dass man sie wiedersehen möchte und sich schon auf das nächste Treffen, das nächste Buch freut.“ Das sollte der Tenor sein.
Natürlich wollte ich auch zwischendrin auf das aktuelle Buch eingehen. Und da beginnen nun meine Probleme. Der neue Krimi ist richtig schlecht. Und nicht nur der Plot.
Viel hilft nicht unbedingt viel
Im Laufe der Jury-Krimis – der gegenwärtige ist ungefähr der 21., ich habe den Überblick verloren – ist ein recht stattliches Personal zusammengekommen, das immer weiter mitgeschleppt wird. Und da jede Figur ihren kurzen Auftritt bekommt, schwillt die Geschichte allein deswegen reichlich an. Das war anfangs nett, als die Schar der Personen noch übersichtlich war. Ihre Schrulligkeit hat sehr viel Spaß gemacht. Doch nach einundzwanzig Büchern ist selbst die schrulligste Schrulligkeit langweilig geworden und der witzigste Running Gag hat seinen Drive verloren. Die charmant-boshafte Lästerrunde im dörflichen Long Piddleton ist längst zum schalen Stammtisch verblasst, und aus Tante Agathas Gier kann auch kein Eremit oder Ziegenbock noch eine lustige Seite herauskitzeln.
Und dann die ganzen Erinnerungen an alte Fälle. Herrje, ich hab doch keine zwanzig Romane – oder mehr – im Kopf, um nach zwanzig Jahren noch zu wissen, wer denn jetzt wer ist oder war. Dazu kommen haufenweise Klischees: Natürlich müssen aufgeweckte, altkluge Kinder – die schon viel durchgemacht haben – eine wichtige Rolle spielen: gegenüber Jury vertrauensvoll, gegenüber Melrose Plant herablassend. Nicht zu vergessen die Hunde. Seit dem letzten Buch sind es drei Stück, die stets erwähnt werden müssen. Außerdem ein Kater. Dazu kommen dann noch pfiffige alte Leute, die keine Gehhilfe brauchen, weil sie vom Korsett der Klischees sehr stabil aufrecht erhalten werden. Zum Glück sind zumindest die Szenen mit Mrs. Wasserman nicht mehr so rührselig wie früher.
Damit sind dann schon einmal achtzig Prozent der Seiten gefüllt. Bleiben noch zwanzig für das Verbrechen. Natürlich Mord. Mindestens einer. Im letzten Buch – »Inspektor Jury kommt auf den Hund« – war das eigentlich ganz charmant gelöst: Stringtheorie, Quantenphysik, sprechende Hunde, Schrödingers Katze. Das war zumindest recht ungewöhnlich und hübsch abstrus. Natürlich überkonstruiert, aber bei Krimis, die in der Tradition von Agatha Christie stehen, ist das selbstverständlich Programm. Auch der aktuelle Krimi ist überkonstruiert, aber auf eine schwerfällige und langweilige Art. Nett sind nur die Verweise auf Henry James und die Verschachtelung der Auflösung. Nach zwanzig Inspektor-Jury-Büchern spielt Frau Grimes mit den Elementen des Krimis, das sei ihr gegönnt. Schöner wäre es, sie würde es etwas besser beherrschen.
Und manchmal ist weniger mehr – zumindest an den richtigen Stellen
Was dem Buch aber letztendlich den Todesstoß gibt, ist die Übertragung ins Deutsche (vom geschmacklosen Titel – so er sich denn auf den Inhalt bezieht – mal ganz zu schweigen). Die Bücher von Grimes landen immer zügig auf der Bestsellerliste des Spiegels. Sie verkaufen sich also nicht schlecht. Der Verlag dürfte ein wenig Geld damit verdienen. Dann muss doch auch etwas übrig sein, um es in das Lektorat der Texte zu stecken. Die Übersetzerin ist gut, keine Frage, aber nicht so gut, dass sie ohne Redaktion auskäme. Der Text ist überfrachtet mit orthografischen Fehlern, grammatikalischen Patzern, stilistischen Eiertänzen und Stilblüten in einer Pracht, dass man ganze Bankettsäle damit schmücken könnte.
Was nett begann, hat sich totgelaufen. Ich lasse es erneut mit Grimes sein – und ob ich es später noch einmal mit ihr probiere, das ist fraglich. Schließlich wird die gute Frau aus Pittsburgh auch nicht jünger. Ob sie mit ihren 71 Jahren noch einmal die Richtung wechselt, steht in den Sternen. Und eine Rezension zu „Inspektor Jury lässt die Puppen tanzen“ werde ich auch nicht schreiben.
 Martha Grimes: Inspektor Jury lässt die Puppen tanzen
Martha Grimes: Inspektor Jury lässt die Puppen tanzen
Deutsch von Cornelia C. Walter
Goldmann 2008, 384 Seiten, 19,95 Euro
ISBN: 978-3-442-31125-5