Die eigenwilligste Privatdetektivin der Welt
 Rund anderthalb Jahre, nachdem Hurrikan Katrina New Orleans zerstört hat, erhält die Privatdetektivin Claire de Witt den Auftrag, den bekannten Staatsanwalt Vic Willing zu suchen. Kurz vor dem Hurrikan hatte er noch mit seinem Neffen telefoniert, seitdem fehlt jede Spur. Mit Claire deWitt hat Willings Neffe nicht irgendeine Privatdetektivin engagiert, sondern – wie sie gern belegt – die beste der Welt. Und auch die vermutlich schrägste. Sara Gran hat mit deWitt eine der ungewöhnlichsten Ermittlerinnen der Kriminalliteratur geschaffen: gewaltbereit, schroff, beinhart, sarkastisch und gleichzeitig zerbrechlich und schutzlos, ohne einen Hauch zart oder weich zu sein.
Rund anderthalb Jahre, nachdem Hurrikan Katrina New Orleans zerstört hat, erhält die Privatdetektivin Claire de Witt den Auftrag, den bekannten Staatsanwalt Vic Willing zu suchen. Kurz vor dem Hurrikan hatte er noch mit seinem Neffen telefoniert, seitdem fehlt jede Spur. Mit Claire deWitt hat Willings Neffe nicht irgendeine Privatdetektivin engagiert, sondern – wie sie gern belegt – die beste der Welt. Und auch die vermutlich schrägste. Sara Gran hat mit deWitt eine der ungewöhnlichsten Ermittlerinnen der Kriminalliteratur geschaffen: gewaltbereit, schroff, beinhart, sarkastisch und gleichzeitig zerbrechlich und schutzlos, ohne einen Hauch zart oder weich zu sein.
Drogen, Logik und Visionen
DeWitt vertraut ihrer Intuition und ihrer messerscharfen Logik ebenso wie ihren Träumen und Visionen. Da sie sehr offen für halluzinogene Drogen und Alkohol ist, sind diese auch nicht selten. Außerdem befragt die Detektivin das »I Ging«. Ihr wichtigstes Werkzeug jedoch ist das Handbuch »Détection« des mysteriösen französischen Detektivs Jacques Silette aus dem Jahr 1959: ein seltsam vages, in sich widersprüchliches Kompendium, dessen Anhänger sich gegenseitig erkennen, da sie alle auf der Suche nach der hässlichen Wahrheit sind.
»Niemand wird dem Detektiv für seine Arbeit danken«, schrieb Silette. »Man wird ihn verachten, in Frage stellen, verabscheuen, bespucken. (…) Sein Lohn ist nichts als die hässliche, unerträgliche Wahrheit. Genügt ihm das nicht, hat er den falschen Beruf gewählt und sollte seine Berufung überdenken.«
Held und Monster
Um die hässliche Wahrheit geht es auch im Fall des ver- schwundenen Staatsanwalts. Der war einer der wenigen, die sich in New Orleans gegen Korruption und organisiertes Verbrechen stark machten, bekannt als aufrechter Vertreter seines Berufsstandes. Einer der Guten also? Doch so einfach ist es nicht. Keine der Figuren bei Gran ist entweder gut oder böse – oder irgendwie ein bisschen was von beidem. Die Wahrheit ist, dass jeder bewundernswert und abstoßend ist, Held und Monster, gleichzeitig und ohne Abstriche.
Jenseits jeglicher Klischees
»Die Stadt der Toten« ist als Auftakt einer Serie gedacht – und die verspricht viel. Denn Gran legt einen atemberaubenden Roman vor: von großer Komik, beißendem Sarkasmus, knacktrockener Ironie, unerträglicher Wahrheit und schmerz- hafter Zerbrechlichkeit.
»Also gut«, sagte ich, »wann haben Sie Ihren Onkel das letzte Mal getroffen?«
»Getroffen?«, sagte Leon. »Getroffen?« Ich sah vor meinem geistigen Auge, wie er seinen Onkel mit einer Axt traf und in zwei Teile hieb.
Jenseits jedes New-Orleans-Klischees zeigt Gran die tiefen Wunden, die der Hurrikan, der versagende Katastrophenschutz und das fatale Missmanagement der Stadt und den Menschen geschlagen hat und die längst noch nicht verheilt sind: die immer noch verwüsteten Straßenzüge, den Immobilienwucher, die Bandenkriminalität. In diesem Chaos eine Person zu finden, die schon seit so langer Zeit verschwunden ist, scheint ein hoffnungsloses Unterfangen – und doch entdeckt Claire deWitt weit mehr, als sie je erwartet hätte. Aber das bedeutet nicht, dass am Ende alles gut ist.
Der Auftraggeber kennt die Lösung des Rätsels bereits. Aber er sträubt sich dagegen. Er beauftragt den Detektiv nicht, um das Rätsel zu lösen. Er beauftragt ihn, um sich bestätigen zu lassen, dass es keine Lösung gibt.
Ein ganz grandioser, eigenwilliger und intelligenter Krimi.
 Sara Gran: Die Stadt der Toten
Sara Gran: Die Stadt der Toten
(Claire deWitt and the City of the Dead, 2011)
Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné
Droemer 2012
Brosch., 361 Seiten, 14,99 Euro
ISBN 978-3-426-22609-4
auch erhältlich als eBook (hier klicken)
Diese Besprechung ist zuerst erschienen auf hr-online.
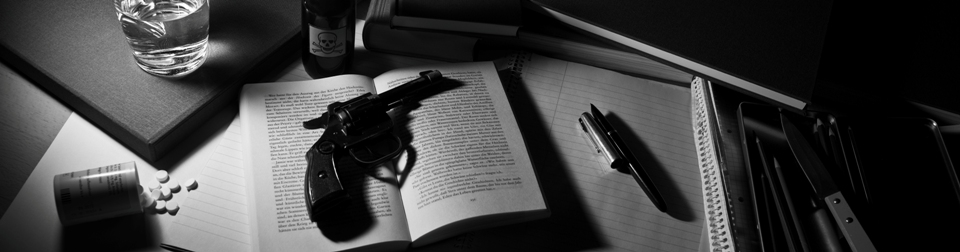
 es stets, sein Gegenüber zu überzeugen, dass es doch besser wäre zu zahlen. Aber nach all den Jahren reicht es ihm. Killian will sich zur Ruhe setzen, etwas völlig anderes machen, sein Architekturstudium beenden. Da wird ihm ein letzter Job angeboten: Für eine halbe Million Pfund soll er die Exfrau eines millionenschweren Unternehmers finden. Damit hätte Killian ausgesorgt. Aber wie es so ist bei letzten Jobs: Alles verläuft vollkommen anders als geplant.
es stets, sein Gegenüber zu überzeugen, dass es doch besser wäre zu zahlen. Aber nach all den Jahren reicht es ihm. Killian will sich zur Ruhe setzen, etwas völlig anderes machen, sein Architekturstudium beenden. Da wird ihm ein letzter Job angeboten: Für eine halbe Million Pfund soll er die Exfrau eines millionenschweren Unternehmers finden. Damit hätte Killian ausgesorgt. Aber wie es so ist bei letzten Jobs: Alles verläuft vollkommen anders als geplant. einem Landsitz kommen fünf Personen zusammen, die auf den ersten Blick nichts gemein haben, abgesehen davon, dass sie zur Testamentseröffnung des vor kurzem verstorbenen Monsieur Louis geladen sind. Und wie es sich gehört für Geschichten, die auf abgelegenen Anwesen spielen, wird die Besucherschar nach und nach dezimiert. Erzählt wird die Begebenheit von Aimé, dem unbedarften Hausknecht, der in seiner naiven Sprech- und Sichtweise die Doppelmoral der besseren Gesellschaft entlarvt, ihre Gier und Lächerlichkeit, ihre Überheblichkeit und ihren Egoismus.
einem Landsitz kommen fünf Personen zusammen, die auf den ersten Blick nichts gemein haben, abgesehen davon, dass sie zur Testamentseröffnung des vor kurzem verstorbenen Monsieur Louis geladen sind. Und wie es sich gehört für Geschichten, die auf abgelegenen Anwesen spielen, wird die Besucherschar nach und nach dezimiert. Erzählt wird die Begebenheit von Aimé, dem unbedarften Hausknecht, der in seiner naiven Sprech- und Sichtweise die Doppelmoral der besseren Gesellschaft entlarvt, ihre Gier und Lächerlichkeit, ihre Überheblichkeit und ihren Egoismus. Von ganz anderer Dunkelheit ist Peter Temples Thriller »Tage des Bösen«. Zwar ist er im Original bereits 2002 erschienen und erst jetzt übersetzt worden, doch diese zehn Jahre merkt man dem Buch in keiner Weise an. Kühl, lakonisch und mit bitterem Witz zeichnet Temple eine Welt, in der Informationen das wertvollste Gut sind. Die Firma W & K in Hamburg hat sich darauf spezialisiert, Informationen zusammenzutragen, egal aus welcher Quelle, egal für welchen Auftraggeber, egal für welchen Zweck. Gleichgültig auch die Frage nach der Legalität. Ungestellt ebenso die Frage, welche Konsequenzen sich aus den gelieferten Informationen ergeben – bis ein brisantes Video auftaucht, für das dubiose Organisationen zu töten bereit sind.
Von ganz anderer Dunkelheit ist Peter Temples Thriller »Tage des Bösen«. Zwar ist er im Original bereits 2002 erschienen und erst jetzt übersetzt worden, doch diese zehn Jahre merkt man dem Buch in keiner Weise an. Kühl, lakonisch und mit bitterem Witz zeichnet Temple eine Welt, in der Informationen das wertvollste Gut sind. Die Firma W & K in Hamburg hat sich darauf spezialisiert, Informationen zusammenzutragen, egal aus welcher Quelle, egal für welchen Auftraggeber, egal für welchen Zweck. Gleichgültig auch die Frage nach der Legalität. Ungestellt ebenso die Frage, welche Konsequenzen sich aus den gelieferten Informationen ergeben – bis ein brisantes Video auftaucht, für das dubiose Organisationen zu töten bereit sind.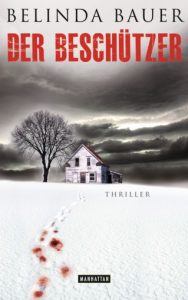 muss einer aus dem Örtchen sein – »Einer von uns!!« –, denn Shipcott ist wegen starken Schneefalls von der Außenwelt abgeschnitten.
muss einer aus dem Örtchen sein – »Einer von uns!!« –, denn Shipcott ist wegen starken Schneefalls von der Außenwelt abgeschnitten.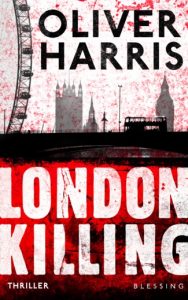 Nach Jahren der Spielsucht und dank eines ausgewachsenen Alkoholproblems ist der Polizist nun so pleite, dass er sogar aus der heruntergekommenen Absteige, in der er zuletzt gewohnt hat, hinausgeworfen wurde. Eigentlich ist er vom Dienst suspendiert, doch bislang konnte er das vor seinen Kollegen und sogar vor seinem direkten Vorgesetzten verbergen.
Nach Jahren der Spielsucht und dank eines ausgewachsenen Alkoholproblems ist der Polizist nun so pleite, dass er sogar aus der heruntergekommenen Absteige, in der er zuletzt gewohnt hat, hinausgeworfen wurde. Eigentlich ist er vom Dienst suspendiert, doch bislang konnte er das vor seinen Kollegen und sogar vor seinem direkten Vorgesetzten verbergen.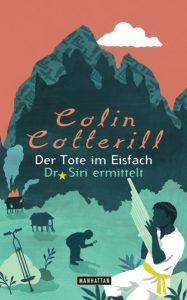 »Der Tote im Eisfach« ist der fünfte Band von Colin Cotterills Reihe um den einzigen und mithin ältesten Pathologen Laos’, den über siebzigjährigen Dr. Siri Paiboun. Siri war aktiv am Kampf gegen den Kolonialherren Frankreichs beteiligt und stand zu dieser Zeit der kommunistischen Partei nah – doch seit Ende 1975 die Laotische Revolutionäre Volkspartei in der kurz zuvor deklarierten Demokratischen Volksrepublik Laos die Macht übernommen hat, ist der Pathologe angesichts der gravierenden Diskrepanz zwischen kommunistischer Proklamation und ihrer Wirklichkeit sowie aufgrund der massiven Kontrolle durch die ideologischen Schwesternstaaten mehr als desillusioniert. Die Ideale des Sozialismus liegen Dr. Siri weiterhin am Herzen, doch die Umsetzung Mitte der siebziger Jahre (zu dieser Zeit spielen Cotterills Krimis) betrachtet er mit großer Skepsis und kommentiert sie zynisch.
»Der Tote im Eisfach« ist der fünfte Band von Colin Cotterills Reihe um den einzigen und mithin ältesten Pathologen Laos’, den über siebzigjährigen Dr. Siri Paiboun. Siri war aktiv am Kampf gegen den Kolonialherren Frankreichs beteiligt und stand zu dieser Zeit der kommunistischen Partei nah – doch seit Ende 1975 die Laotische Revolutionäre Volkspartei in der kurz zuvor deklarierten Demokratischen Volksrepublik Laos die Macht übernommen hat, ist der Pathologe angesichts der gravierenden Diskrepanz zwischen kommunistischer Proklamation und ihrer Wirklichkeit sowie aufgrund der massiven Kontrolle durch die ideologischen Schwesternstaaten mehr als desillusioniert. Die Ideale des Sozialismus liegen Dr. Siri weiterhin am Herzen, doch die Umsetzung Mitte der siebziger Jahre (zu dieser Zeit spielen Cotterills Krimis) betrachtet er mit großer Skepsis und kommentiert sie zynisch.