Zwar sorgfältig konstruiert, aber vorhersehbar
Als die Temperance Brennan zu sich kommt, umgibt sie Schwärze, feuchte Kälte und ein muffiger Geruch: Offenbar ist sie lebendig eingesperrt in einer recht geräumigen Grabkammer. Nach und nach kehren Brennans Erinnerungen an die vergangenen Tage und Wochen zurück.  In der letzten Zeit haben sich zahlreiche merkwürdige Dinge ereignet: Sie war in ihrer Wohnanlage das Ziel mehrer anonymer Attacken (Drohbriefe, eingeschlagene Fensterscheibe, Katzenkot vor der Wohnungstür), und auch an ihrem Arbeitsplatz in Montreal häuften sich eigenartige Vorfälle: Die Expertin für Knochen wurde beschuldigt, unsauber gearbeitet zu haben, Todesursachen falsch eingeschätzt, Knochen am Skelettfundort übersehen und Spuren an alten Zähnen nicht richtig analysiert zu haben. Überarbeitung? Schlampiges Vorgehen? Oder gar Sabotage?
In der letzten Zeit haben sich zahlreiche merkwürdige Dinge ereignet: Sie war in ihrer Wohnanlage das Ziel mehrer anonymer Attacken (Drohbriefe, eingeschlagene Fensterscheibe, Katzenkot vor der Wohnungstür), und auch an ihrem Arbeitsplatz in Montreal häuften sich eigenartige Vorfälle: Die Expertin für Knochen wurde beschuldigt, unsauber gearbeitet zu haben, Todesursachen falsch eingeschätzt, Knochen am Skelettfundort übersehen und Spuren an alten Zähnen nicht richtig analysiert zu haben. Überarbeitung? Schlampiges Vorgehen? Oder gar Sabotage?
Das ist der Auftakt von Kathy Reichs 12. Thriller um die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan. Im Original heißt er deutlich zurückhaltender und in seiner Nüchternheit letztlich treffender »206 Bones«. Nach dem dramatischen Beginn geht es auf zwei Zeitebenen weiter: Während Brennan versucht, sich aus ihrem Gefängnis zu befreien, wird auf einer zweiten Zeitschiene aufgerollt, was in den Wochen zuvor vorgefallen ist: Morde an mehreren älteren Frauen, die offenbar zusammenhängen, zufällig gefundene Skelettreste von mindestens vier Personen, ein anonymer Anrufer, der Brennan der Nachlässigkeit bezichtigt. Und natürlich spielt die reichlich komplizierte Beziehung zu Detective Andrew Ryan eine Rolle, der nun doch wieder gern zu Tempe Brennan zurückkehren würde.
Verwicklungsfreiraum
Abgesehen von dem reißerischen Anfang ist es eigentlich ein recht ruhiges Buch: unspektakuläre Ermittlerarbeit, Verhöre, Untersuchungen von Knochen und Zähnen mit den neuesten technischen Errungenschaften. Wirklich gut und spannend wird es immer dann, wenn Brennan sich in ihre Arbeit vertieft und Reichs unaufgeregt und detailliert, aber sehr verständlich und anschaulich beschreibt, was Brennan tut – kein Wunder: schließlich arbeitet Reichs selbst als forensische Anthropologin. So ist es besonders der Fall der vier alten Skelette, der eine gewisse Sogkraft entwickelt. Leider ist das nur ein Nebenstrang.
Im Mittelpunkt stehen die Morde an den älteren Frauen und die Anfeindungen, gegen die sich Tempe Brennan erwehren muss. Aber das wirkt wie lustlos runtergeschrieben, ohne große Verwicklungen oder Überraschungen. War der letzte Fall »Der Tod kommt wie gerufen« (im Original »Devil Bones«) verworren und opak, so ist es diesmal allzu offensichtlich, was und wer dahintersteckt. Und die Lebendig-begraben-Geschichte ist ein eigenartig aufgepfropfter Block, der wohl etwas Action in den sonst beschaulichen Fortgang bringen soll.
Bei aller Halbherzigkeit ist der Krimi aber natürlich wie alle Thriller von Kathy Reichs gut geschrieben (auch recht gut übersetzt), in sich konsistent und sorgfältig aufgebaut. Aber er überrascht halt an keiner Stelle und wirkt insgesamt eher wie eine langweilige Pflichtübung.
 Kathy Reichs: Das Grab ist erst der Anfang
Kathy Reichs: Das Grab ist erst der Anfang
Aus dem amerikanischen Englisch von Klaus Berr
Blessing 2009
geb., 384 Seiten, 19,95 Euro
ISBN 978-3-89667-323-7
auch erhältlich als eBook (hier klicken)
auch erhältlich als Hörbuch-Download (hier klicken)
Diese Rezension ist bereits erschienen im neu gestalteten Titel-Magazin.
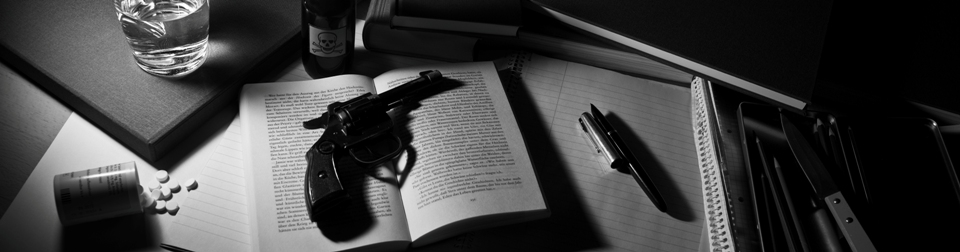
 terrorisiert er Lehrerin wie Teilnehmer gleichermaßen: Die eingereichten Leseproben werden verhöhnt, die Kursmitglieder bös verunglimpft, eine Schülerin fast zu Tode erschreckt; Amy erhält nachts Anrufe, bei denen ein Tonband stets wiederholt, was sie wenige Stunden zuvor im Unterricht gesagt hat. Lag in den Taten anfangs noch ein boshafter Witz, werden sie im Laufe der Zeit immer gemeiner und tückischer. Schließlich kommt gar der erste Kursteilnehmer ums Leben.
terrorisiert er Lehrerin wie Teilnehmer gleichermaßen: Die eingereichten Leseproben werden verhöhnt, die Kursmitglieder bös verunglimpft, eine Schülerin fast zu Tode erschreckt; Amy erhält nachts Anrufe, bei denen ein Tonband stets wiederholt, was sie wenige Stunden zuvor im Unterricht gesagt hat. Lag in den Taten anfangs noch ein boshafter Witz, werden sie im Laufe der Zeit immer gemeiner und tückischer. Schließlich kommt gar der erste Kursteilnehmer ums Leben.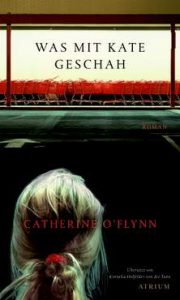 Besonders gut geeignet ist Mickey für Observierungen.
Besonders gut geeignet ist Mickey für Observierungen. nimmt diese Ausgangssituation auf, weiter gehen die Ähnlichkeiten aber nicht.
nimmt diese Ausgangssituation auf, weiter gehen die Ähnlichkeiten aber nicht. fünfzehnjährige John vermutet dahinter einen Serienmörder. Und John muss es wissen: Er ist geradezu besessen von diesem Thema, hält er sich doch selbst für einen angehenden Serienkiller. Als Beleg dient ihm unter anderem Macdonalds Triade, die vollständig auf ihn zutrifft: Bettnässen, Pyromanie und Tierquälerei. Sein Psychotherapeut versucht vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
fünfzehnjährige John vermutet dahinter einen Serienmörder. Und John muss es wissen: Er ist geradezu besessen von diesem Thema, hält er sich doch selbst für einen angehenden Serienkiller. Als Beleg dient ihm unter anderem Macdonalds Triade, die vollständig auf ihn zutrifft: Bettnässen, Pyromanie und Tierquälerei. Sein Psychotherapeut versucht vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.